 |
|
Das Rathaus von 1376 (nach: Aquarell von Ph. Wärtner im Stadtarchiv) |
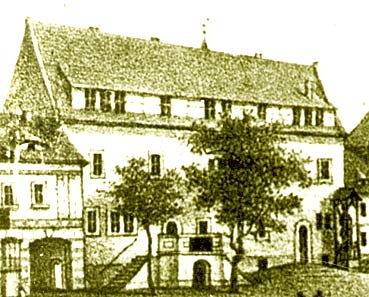 |
|
Das Rathaus in einem Stich von der Mitte des 19. Jahrhunderts (nach: Archiv Fam. Zähle) |
 |
|
Das Rathaus von 1376 (nach: Aquarell von Ph. Wärtner im Stadtarchiv) |
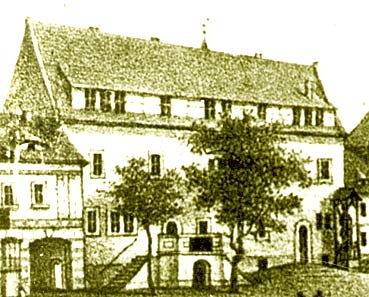 |
|
Das Rathaus in einem Stich von der Mitte des 19. Jahrhunderts (nach: Archiv Fam. Zähle) |
2. Das Rathaus ist seit dem Mittelalter politischer Mittelpunkt jedes städtischen Gemeinwesens. Schon im 11. und 12. Jahrhundert, in der Zeit der städtischen Emanzipationskämpfe, gab es auf dem "Alten Markt" (vor der heutigen Hauptpost) eine "Ratslaube", in der innerstädtische Angelegenheiten verhandelt wurden. 1376 wurde auf dem "Neuen Marktplatz" mit Steinen aus Brumby und Glöthe ein repräsentatives Rathaus errichtet, dessen südliche Giebelwand am jetzigen Rathaus noch zu sehen ist. An den Ausmaßen dieser Wand und anhand alter Bilder erkennt man, dass das Rathaus von 1376 noch etwa 2 m höher war als das jetzige. Architektonisch gesehen war das Calber Rathaus kein Meisterstück. Es gehörte aber in die Reihe der Maßnahmen des Baubooms im 14.Jahrhundert und hatte 2 Stockwerke mit Sälen, die vorwiegend für Ratstagungen und Gerichtsverhandlungen, aber auch für Festlichkeiten, unter anderem auch Hochzeiten, sowohl von den Bürgern als auch von den Landesherren, den Erzbischöfen, genutzt wurden. Das obere Stockwerk wurde nicht nur als Festsaal, sondern auch als Haftlokal genutzt. Dieser Arrestsaal wurde im Volksmund "der Stock" genannt, nach einem Häftling namens Stefan (Steffen) Bars hieß er auch "der Stockbars". (Bars wird 1552 im Urfriedebuch von Calbe genannt und als der bezeichnet, nach dem das Gefängnis seinen Namen hat [K. Herrfurth].) Haftgründe bestanden, wenn man länger als zwei Tage totes Vieh, Mist oder Unrat vor seinem Haus auf der Straße liegen ließ, wenn man die Arbeit bummelte bzw. einen "blauen Montag" einlegte, wenn man Schulden nicht beglich oder wenn man als Neubürger seinen Beruf ausübte, bevor man sein Burmahl (Bürgermahl) gegeben hatte.
Der im Untergeschoss des Rathauses untergebrachte Ratskeller mit seinen erheblichen gastronomischen Privilegien war eine wichtige Einnahmequelle der Stadtkämmerei. (Auf dem Aquarell unten sieht man den Ratskellereingang unter dem Treppenportal.)
Nach der preußischen Gebietsreform 1815, in der Calbe Kreisstadt geworden war, wurde hier 1817 im "Stock" vorübergehend das Königliche Kreisgericht untergebracht.
Der Rat der Stadt setzte sich im Mittelalter aus vier Mitgliedern zusammen: dem Bürgermeister, dem Kämmerer (so viel wie: Vermögensverwalter und Finanzbeamter) und zwei weiteren Ratsherren. Alle drei Jahre wurde ein neuer Rat gewählt. Außer dem Kämmerer, dessen Amt für die drei Jahre fest blieb, wechselte das Bürgermeisteramt bei den restlichen drei jährlich [laut Hertel, Gustav, Geschichte ...]. Nach den Recherchen von K. Herrfurth war auch das Amt des Kämmerers in diesen Wechsel mit einbezogen. Die städtische Politik regelte der jeweils amtierende Bürgermeister allein, nur bei besonders wichtigen Entscheidungen wurden die anderen Ratsmitglieder hinzugezogen. Viermal im Jahr wurde das so genannte Burding (entstanden aus dem alten germanischen Wort "Thing"), eine Versammlung der städtischen Oberschicht (Patriziat), gehalten. Zu dem regelmäßig danach stattfindenden "Burmahl" wurden auch die Vertreter der städtischen Mittelschicht (Zunftmeister und Kleinkaufleute) eingeladen. Die Ratswahl wurde unter Aufsicht des erzbischöflichen Vogtes durchgeführt. Erst unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft wurde das "Rotationsprinzip" aufgegeben und 1708 der wechselnde Rat in einen ständigen Magistrat umgewandelt. Als Kontrollorgan war die Einrichtung der "Sechsmänner" ins Leben gerufen worden. Sie waren ein Zugeständnis an die Forderungen der städtischen Mittel- und Unterschichten, der Unmäßigkeit des Patriziats einen Riegel vorzuschieben. Die Sechsmänner wurden 1496 erstmals als Vertreter der drei Stadtteile gegenüber dem Rat erwähnt. Das Organ der Schöffen war mit dem städtischen Gerichtswesen beschäftigt. Calbe hat sich nie ganz von feudaler Vormundschaft befreien können. Bis in die Reformationszeit hatten die Erzbischöfe bzw. ihre Stellvertreter, die Vögte, die Herrschaft über die Stadt, und die Bürger mussten die Beden (Feudalsteuern) abliefern, später in Geldform. Die Vögte hatten auch Einfluss auf die Besetzung des Rates (vgl. Reccius, Chronik ..., S. 23 unter 1392). Allerdings wussten kluge Landesherren, wie z. B. Dietrich Portitz und andere im Gegensatz zur Erzbischof Burchard III. (vgl. Station 11), dass man Städte fördern musste, um einen Nutzen von ihnen zu haben. 1600 erhob der Rat den Anspruch, nicht mehr dem Nachfolger des Vogtes, dem Schlossamt als Stellvertreter des Magdeburger Administrators, sondern nur noch der erzbischöflichen Regierung unmittelbar zu unterstehen (vgl. Reccius, Chronik ..., S. 23 unter 1392).
 |
|
Rathaus von 1876 mit Rolandfigur |
Als Erzbischof Ludwig in der Fastenzeit des Jahres 1382 einen "großen Hof" für Fürsten und Ritter in Calbe abhielt, wurde gerade dieses neu erbaute Rathaus in die Festivitäten einbezogen. Beim Fastnachtstanz am 17. Februar im Stock brach Feuer aus; Boden und Treppe stürzten ein. Der Erzbischof fand bei dieser in ganz Deutschland beachteten Katastrophe den Tod. Das Rathaus wurde rasch wieder in Stand gesetzt. Aber erst fast fünfhundert Jahre später, im Jahre 1875, vernichtete ein Feuer das mittelalterliche Rathaus so gründlich, dass 1876 ein vollkommen neues, diesmal nach dem Geschmack der Gründerzeit im eklektizistischen Neorenaissance-Stil, errichtet wurde. Bauinspektor Fiebelkorn hatte es entworfen, und von Maurermeister Förster, demselben, der auch die Schule am Kirchplatz (vgl. Station 7) gebaut hatte, war es ausgeführt worden. Diese Architektur wirkt allerdings auf uns Heutige etwas kalt im Ensemble der noch vorhandenen, ringsum stehenden Spätrenaissance- und Barockbauten.
Vor dem Rathaus befand sich der Rathausbrunnen mit einem Schieferdach, und daneben ein Kaufhaus der Brotbäcker (Brotscharren). Vor dem Rathaus war während des Dreißigjährigen Krieges eine Art steinerne Barrikade errichtet worden, das so genannte Bollwerk oder "Rondell", um das öfters erbittert, teilweise auch erfolgreich gekämpft wurde.
Während der Preußenzeit stand vor dem Rathaus ein Wachlokal der Garnison (vgl. Station 18); ein solches "Corps de garde" gab auch auf dem Alten Markt. In der Nähe des Rathauses war eine große Badestube zu finden, ebenso wie auf dem Alten Markt an der Badergasse (vgl. Station 10).
Seit der Gründerzeit stand auf dem Marktplatz, etwa da, wo heute der Springbrunnen rauscht, das Denkmal für Kaiser Wilhelm I. und die Calber Gefallenen von 1863 - 1871.
Als im Rahmen des großen Calber Baubooms im letzten Drittel des 14.Jahrhunderts das neue zweistöckige Rathaus am "Neuen" Marktplatz gebaut wurde, tauchte in den Calbeschen Stadtrechnungs-Akten 1382 für 1381 eine Rolandfigur auf. Damit ist unser Roland der drittälteste urkundlich nachweisbare im deutschen Raum.
Was hat es mit diesen inzwischen selten gewordenen Rolandfiguren auf sich?
Die
hölzernen und steinernen Riesen sind schon eigenartige Gesellen. Über
Jahrhunderte wurden Rolandstatuen gehegt und gepflegt, aber über ihren
ideellen Ursprung und ihre Bedeutung wissen wir nichts. In der Tatsache,
dass es keine Aufzeichnungen darüber gibt, darf man wohl ein sicheres
Zeichen dafür sehen, dass den Menschen des Mittelalters der Sinngehalt
der Standbilder so selbstverständlich war, dass sie es für überflüssig
hielten, darüber Ausführungen zu machen. Die einzigen Vermerke, mit
denen die Existenz der Respektfiguren beurkundet wird, sind oft nur
prosaische Kämmereirechnungen, die sich - wie beim Roland von Calbe -
auf die Restaurierung oder Umlagerung der Rolande beziehen. a) über den Ursprung: Entstehung aus Marktkreuzen, aus Ahnen- und Gerichtspfählen, aus Figuren der Rolandspiele oder aus vorchristlichen Götterbildern (z. B. Irminsul der Sachsen); b) über die
Bedeutung: Sie seien Darstellungen Kaiser Karls des Großen oder Kaiser
Ottos II., Abbilder von Fürsten, Königen oder von Richtern, Zeichen des
Marktes, des Stadtrechtes, der Reichsunmittelbarkeit, Demonstration von
besonderen Privilegien und Freiheiten (z. B. Handelsvorrechten), Zeichen
des Blutbannes, der Autonomie der Stadt gegenüber dem Stadtherrn, der
Herrschaft des Rates und der freien Bürgergemeinde und schließlich
Sinnbilder des Stadtfriedens (vgl. Pötschke, a. a. O., Abs. 50 – 65).
Die Zeit, in der unsere Rolandstatue plötzlich in
den Quellen auftauchte, war die Epoche des zweiten großen Aufstiegs der
Stadt Calbe.
Mit 31 Jahren
(1647) war der Tscheche Vaclav (Wenzel) aus dem Herrscherhause Luxemburg
böhmischer König geworden. 1346 wählten ihn auf Betreiben Papst Klemens’
VI. fünf Kurfürsten zum Gegenkönig von Ludwig IV. dem Bayern. Nachdem er
sich auch noch gegen den von den Wittelsbachern aufgestellten Gegenkönig
Günther von Schwarzburg durchgesetzt hatte, wurde er im Reich allgemein
anerkannt. Bei der Festigung seiner Macht half ihm ein Ideal. Während
der Zeit seiner Firmung am französischen Hof (1323 – 1330) hatte er
nicht nur den fränkischen Herrschernamen "Karl" angenommen, sondern auch
den besonders seit dem 12. Jahrhundert in Westeuropa wirkenden Kult um
Karl den Großen und seinen Paladin Roland von der Bretagne kennen
gelernt und verinnerlicht. 1355 wurde Karl in Rom von einem päpstlichen
Legaten unter dem Regentennamen Karl IV. zum Kaiser gekrönt. (Die Päpste
hatten sich wegen der drohenden Gefahren zwischen 1309 und 1377 von Rom
nach Avignon geflüchtet.) Der fähige Kaiser, der durch eine geschickte
Hausmacht- und Heiratspolitik, durch den Verzicht der Kaisermacht in
Reichsitalien und durch gesetzliche Regelung der Rechte der Kurfürsten
(Goldene Bulle) von sich reden machte, hatte zwei Ziele vorrangig im
Auge: die Schaffung stabiler (kaiserlicher) Machtverhältnisse im Reich
und die Konsolidierung der Wirtschaft darin. Dabei gab er der Diplomatie
gegenüber der militärischen Gewalt den Vorzug.
Dietrich Portitz, genannt „Kagelwit“ wegen seiner weißen Zisterzienser-Kapuze, stammte aus einer Stendaler Patrizierfamilie. Der Sohn eines Gewandschneiders und Kaufmanns wurde Zisterzienser-Mönch. Mit 46 Jahren, nachdem die Kurfürsten den Böhmen Vaclav zum König gewählt hatten, begann seine Staatskarriere. Er erhielt verschiedene Bischofsämter und wurde 1347 vom König in den Staatsdienst aufgenommen. Dietrich Portitz leitete seit 1352 maßgebend und erfolgreich die Verhandlungen des Königtums mit der päpstlichen Kurie in Avignon, vor allem wegen der Kaiserkrönung, und leistete dem künftigen Kaiser bei der Erwerbung der Kurmark Brandenburg hervorragende Dienste. Durch Kagelwit kam Karl auch dazu, seinen nach Prag zweiten Residenzsitz in die Nähe Stendals, nach Tangermünde zu verlegen. Nach der Krönung Kaiser Karls IV., wuchs der politische und wirtschaftliche Einfluss Dietrichs weiter an. 1355 bis 1361 wurde er mit der Aufsicht über die Finanzverwaltung Böhmens betraut, 1360 Kanzler von Böhmen und gleichzeitig der Stellvertreter des Kaisers im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Nicht nur in dieser Funktion stützte sich Dietrich als eifriger Verfechter der Zentralgewalt auf die Städte im Reich. Als des Kaisers „rechte Hand“ wurde er 1361 als Theodericus (Dietrich) Erzbischof von Magdeburg und 1362 auf drei Jahre Mitregent des Markgrafen von Brandenburg. Damit war er nach dem Kaiser der wichtigste und mächtigste Mann im Reich. Sein in Böhmen erworbenes Vermögen verwandte er dazu, die verpfändeten magdeburgischen Festen und Schlösser wieder an das Erzstift zu bringen und aufwändige Bauten zu errichten (vgl. Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 4, Leipzig 1888, S. 960). Mit Hilfe seiner Landfriedensurkunde von 1363 (vgl. Rocke, a. a. O., S. 71) versuchte er, das Fehden-Unwesen der partikularen Herrscher mit dem Ziel eines starken Kaisertums zu bekämpfen, wobei ihn die Magdeburger, Calbenser und Altmärker mit Mannschaften unterstützten. Dabei fiel im Kampf neben anderen auch Heinrich von Gribehne, und Klaus von Bismarck wurde gefangen genommen (vgl. Reccius, a. a. O., S. 20). Am 17. oder 18. Dezember 1367 starb Erzbischof Dietrich, der bedeutende Politiker, Wirtschaftsfachmann und Förderer Calbes. In den sechs verbleibenden Jahren seit seinem Antritt als Magdeburger Landesherr hat Dietrich Portitz mehr für Calbe getan als die Erzbischöfe in hundert Jahren vor ihm.
Sein für uns Heutige so beeindruckendes Verhalten, seine Tatkraft
und sein Einsatz für die Reichsidee beruhen wohl in erster Linie auf
seiner Herkunft.
In Einhards Biographie von Karl
dem Großen wird erwähnt, dass der Markgraf der Bretagne, Hruotlandus, in
der Schlacht im Tal von Ronceval 778 gefallen war. Später setzte eine
wahre Flut von literarischen Bearbeitungen des Sujets vom treuen
Vasallen und Freund ein. Rolandus wurde in bedeutenden Dichtungen,
welche die Zeitgenossen oft durchaus für die Wahrheit nahmen, zur
„rechten Hand“ Karls und zu seinem „Schwert der Gerechtigkeit“ (spata
iustitie) erhoben. Im „Chanson de Roland“ (um 1100), in der „Historia
Karoli Magni et Rotholandi“ (wahrscheinlich um 1140), in dem deutschen
„Rolandslied des Pfaffen Konrad“ (um 1170), dem Epos des Stricker „Karl
der Große“ und anderen wird dem Leben und besonders dem heldenhaften
„Märtyrertod“ Rolands ein breiter Raum zugestanden. Im Bewusstsein der
Menschen jener Zeit wurde Roland zu einer Heldenfigur, zu dem Ideal des
treuen, selbstlosen und tapferen Vasallen, der bedingungslos für seinen
Herrscher eintrat. Der Sage nach war er nicht nur mit Karl dem Großen
verwandt, sondern auch dessen unverbrüchlicher Freund. Die Kunde vom
loyalen Stellvertreter Karls, dem „Schwert der Gerechtigkeit“,
verbreitete sich in West- und Mitteleuropa rasch und genoss große
Popularität.
Die drei Ausführungen des Rolands von Calbe
Die erste Figur
Leider wissen wir nicht, wie unser erster hölzerner Roland aussah;
lediglich seine Bemalung (1465) und die Ausbesserung seines kleinen
Daches (1473) wurden erwähnt (vgl. Hertel, a. a. O., S.120).
Die zweite Figur Durch eine oberflächliche Interpretation der Quellen bzw. durch die dichterische Freiheit des Lehrers und Stadtgeschichtspublizisten Wilhelm Oswald Richter (1889 - 1965) entstand im 20. Jahrhundert eine Legende, dass sich nach der Begutachtung des neuen, über vier Meter hohen Werkes durch den Rat am 28.Oktober 1656 die Herren kategorisch geweigert hätten, die anatomisch fragwürdige Skulptur anzunehmen, denn die Arme waren gegenüber dem deutlich größeren Kopf und dem Körper zu kurz und zu dünn geraten. Nach vielem Hin und Her hätte der Rat 1658 schließlich doch noch dem Meister den Roland abgekauft. Diese Geschichte wurde bis in die jüngste Zeit bedenkenlos kolportiert.
Klaus Herrfurth konnte jedoch durch Archivrecherchen die Wahrheit
darüber ans Licht bringen. Demnach gab es gar keine Weigerung des Rates,
das im Herbst 1656 angefertigte Werk des Meisters Gottfried Gigas, der
auch die Figuren des Hochaltars in der Stadtkirche geschnitzt hatte,
anzukaufen, vielmehr wurde laut Kämmereirechnung der Roland tatsächlich
ohne Beanstandungen gekauft und alles zu seinem Schutz organisiert.
Die dritte Figur |
Geschichte des Rolands von Calbe
in Daten
|
1376 |
Neues Rathaus erbaut |
|
1382 (nach 8.1.) |
Erste Erwähnung des Rolands für 1381 |
|
1465 |
Neubemalung |
|
1473 |
Reparatur des kleinen Roland-Daches |
|
1652/53 |
Vergebliche Reparaturarbeiten an der 300 Jahre alten Holzfigur |
|
1656 (28.10.) |
Der neue Roland des Magdeburger Holzschnitzmeisters Gottfried Gigas, der zu dieser Zeit auch die Figuren des Hochaltars in der Stadtkirche geschaffen hat, wird vor dem Rathaus rechts aufgestellt, mit einem Gitter umgeben und der Boden darunter gepflastert. Größe: ca. 4m |
|
1658 (24.9.) |
Kompromiss im Streit zwischen dem Rat der Stadt Calbe und den landesfürstlichen Beamten des Administrators August von Sachsen-Weißenfels um die Rechtmäßigkeit der Neuaufstellung |
|
Um 1720 |
Der Roland steht noch an der gleichen Stelle in einer „Laube“ mit Dach und Gitterumrandung. An einem Laubenpfosten befindet sich das „Halseisen“ zum Prangerstehen. |
|
1870/71 |
Die Figur erhält anlässlich des gewonnenen Krieges gegen Frankreich und der Gründung des Deutschen Kaiserreiches einen bronzefarbigen Anstrich und eine schwarz-weiß-rote Schärpe |
|
1875 |
Brand des gotischen Rathauses und Abriss der Reste. Der Roland verschwindet in einer Scheune. |
|
1876 |
Einweihung des Backstein-Rathauses im wilhelminischen Neo-Renaissance-Stil. Den Roland will man hier nicht mehr haben. Er bleibt in seinem „Verlies“. |
|
1882 |
Die Rolandfigur wird an der Nordwand der 1857 erbauten Knaben-Volksschule unter einem Schiefer-Baldachin aufgestellt. Um ihn herum wird der Rolandgarten angelegt. |
|
1936 |
Anlässlich der 1000-Jahr-Feier Calbes wird das Sinnbild wieder an seinem alten Platz rechts vor dem Rathaus aufgestellt. |
|
1943 |
Wegen der zunehmenden Bombenflieger-Angriffe der Alliierten wird die Figur auf den Wartenberg in die untere Halle des Bismarck-Turmes ausgelagert. |
|
1946 |
Umlagerung der durch die Luftfeuchtigkeit in der Halle stark beschädigten Holzfigur in einen Raum innerhalb der Zuckerfabrik |
|
1946/47 |
In diesem Nachkriegs-Hungerwinter lässt eine extreme, anhaltende Kälte viele Menschen buchstäblich erfrieren. Der Roland wird bis auf den Schild verheizt. |
|
1976 (2. Juli) |
Nach jahrelangen vergeblichen Initiativen der Bürger wird ein vom Bildhauer Eberhard Glöss in Anlehnung an die Figur von 1656 geschaffener Sandstein-Roland (rechts vor dem Rathaus) enthüllt. Größe: 4,5m |
Alphabetisches Verzeichnis der Orte, in denen es Darstellungen Rolands und Hinweise auf ihn gibt
(nach einer Auflistung, die mir freundlicherweise von Frau Dr. iur. D. Munzel-Everling zur Vorabveröffentlichung zur Verfügung gestellt wurde. Dafür meinen herzlichen Dank!)
|
Aachen |
|
|
Alvensleben |
reitender Roland, Dachziegel, ca. 1828 |
|
Amsterdam (NL) |
steinerne vermeintliche Rolandfigur, um 1520, untergegangen |
|
Angermünde |
hölzerne Rolandfigur, um 1420, untergegangen |
| Angoulême (F) | Reliefdarstellung an der Kirche, um 1120 |
| Arnstadt | steinerne Brunnenfigur von 1593, vermeintlicher Roland |
| Aurich | hölzerne Figur, Hauszeichen eines Gasthauses, um 1820 |
| Bad Bederkesa | steinerne ehemalige Brunnenfigur, um 1602 |
| Bad Bramstedt | steinerne Figur, erstmals um 1483 errichtet |
| Bad Pyrmont | Bismarck-Roland von 1913 |
| Bad Segeberg | Rolandfigur auf einer Säule, um 1550, untergegangen |
| Bad Sulza | Rolandfigur, um 1593 errichtet, derzeit nicht belegbar, untergegangen |
| Bad Windsheim | Figur am Kriegerdenkmal, 1928 errichtet |
| Ballerstedt | Roland, um 1580, untergegangen |
| Bardejow (SK) | Roland, auf dem Rathausdach, 1641 errichtet |
| Bautzen | steinerne Brunnenfigur von 1576, vermeintlicher Roland |
| Belgern | steinerne Figur, 1550 erstmals errichtet |
| Bennungen | hölzerne Rolandfigur, 1606 aufgestellt, untergegangen |
|
Berlin |
|
| Bernau | Rolandfigur, Mitte des 15. Jhs., untergegangen |
| Beverungen | Roland als Kriegerdenkmal auf einem Brunnen, 1929 errichtet, untergegangen |
| Blaye (F) | Grab Rolands, untergegangen |
| Boitzenburg | Roland auf dem Grabstein des Rolandforschers Mann |
| Brakel | Rolandfigur auf einer Marktsäule, um 1500 ?, untergegangen |
|
Brandenburg
|
|
| Bratislava (Preßburg)(SK) | steinerne Brunnenfigur von 1572 |
Bremen
|
|
| Brindisi (I) | Mosaik von 1779 mit Motiven der Schlacht von Roncevalles, untergegangen |
| Brioude (F) | Darstellung des Reiterkampfes Roland-Ferragut von 1140 |
| Brissago (CH) | Rolandfigur von 1905 im Park der Villa von Leoncavallo |
| Brobergen | hölzerner Roland, 1525 erwähnt, untergegangen |
| Buch | hölzerner Roland von 1580, steinerner von 1693 |
| Burg | hölzerner Roland von 1521, steinerner von 1581, neu errichtet 2000 |
| Burghorn (NL) | hölzerne Prangerfigur von 1505, untergegangen |
| Butzbach | steinerne Brunnenfigur von 1575 |
| Buxtehude | hölzerne Prangerfigur, Anfang 18. Jh., untergegangen |
| Calbe/Saale | Hölzerne Figur vor 1376, 1382 für 1381 erstmals erwähnt, neue Holzfigur von 1656, Kopie in Stein von 1976 (s. Text oben) |
| Cedynia (Zehden) (PL) | hölzerne Figur um 1450, erneuert 1739, Torso erhalten |
|
Chartres (F) |
|
| Cheb (Eger) (CZ) | hölzerne Brunnenfigur von 1528, durch steinerne ersetzt 1591 und 1985 |
| Chemnitz | steinerne Figur am Rathaus von 1910 |
| Chojna (Königsberg i. d. Neumark) (PL) | Holzfigur auf Prangersäule von 1648, untergegangen |
| Cluny (F) | Hornbläserfigur von 1130 |
| Conques (F) | Hornbläser und Kämpfer, um 1100 |
| Cottbus | steinerne Figur am Rathaus von 1934, untergegangen |
| Cremona (I) | Hornbläserfigur von 1160 |
| Crimmitschau | Zinkblechfigur von 1892 auf dem Rathaus, 1924 und 1994 aus Kupferblech erneuert |
| Cumlosen | hölzerne Figur, nur aus der Sage bekannt |
| Cunault (F) | Darstellung aus dem Rolandslied, um 1140 |
| Dessau | Bismarck-Roland von 1908, untergegangen |
| Dole (F) | steinerne Figur um 1400, erneuert oder restauriert 1719 |
| Dortmund | Reinoldus-Statue aus Holz von 1330, als „Roland“ bezeichnet |
| Dreye | Holzfigur vom Mast einer Kogge, um 1420, vermeintlicher Roland |
| Drosendorf (A) | Prangerfigur von 1560, erneuert 1616 und 2000 restauriert |
| Dubrovnik(Ragusa) (HR) | hölzerne Figur von 1396 ?, 1417 in Stein erneuert |
| Duisburg | steinerne Figur am Rathaus von 1902, |
| Eggenburg (A) | Prangerfigur von 1620 |
| Elblag (Elbing) (PL) | hölzerne Figur von 1404, untergegangen |
| Elze | Figur am Kriegerdenkmal, 1925 errichtet |
| Erfurt | steinerne Figur eines Römers von 1591, als „Roland“ bezeichnet |
| Estella (SP) | Roland im Kampf mit Ferragut, um 1160 |
| Eutin | steinerne Figur von 1583, 1905 Kopie aufgestellt |
| Fidenza (I) | Darstellung der Jugend Rolands an der Kathedrale, um 1230 |
| Finsterwalde | hölzerne Figur von ca. 1500, nicht belegbar, untergegangen |
| Flensburg | Büttelfigur aus Kupfer, als „Roland“ bezeichnet |
| Fritzlar | steinerne Brunnenfigur von 1564 |
| Gansbach (A) | Prangerfigur aus der Mitte des 17. Jhs. |
| Gardelegen | hölzerne Figur von ca. 1440, in Stein erneuert 1564 und 2002 |
| Garding | hölzerne Spielfigur, Mitte des 19. Jhs. |
| Giebichenstein | steinerne Mauritiusfigur, um 1400, als „Roland“ bezeichnet |
| Görlitz | steinerne Brunnenfigur von 1674, als „Roland“ bezeichnet |
| Gorzów Wielkopolski (Landsberg a. d. Warthe) (PL) | hölzerne Figur aus der Mitte des 16. Jhs., untergegangen |
| Göttingen | steinerne Figur von ca. 1387, untergegangen |
| Greifswald | hölzerne Figur von 1398, untergegangen |
| Hagenberg (A) | steinerne Prangerfigur von 1717 |
|
Halberstadt |
|
| Haldensleben | hölzerne Figur von 1419, steinerner reitenden Roland von 1528, Kopie von 1927 |
| Hall/Tirol (A) | steinerne Brunnenfigur von 1522 |
| Halle/Saale | hölzerne Figur von ca. 1245, in Stein erneuert 1719 |
|
Hamburg |
hölzerne Figur von 1342, untergegangen 1389 Bismarck-Roland von 1906 |
|
Hannover |
hölzerner Erd-Roland der Kollwitz-Schule, 2000 Nagel-Roland von 1916, untergegangen |
| Hehlingen | hölzerner Reiter-Roland, um 1400, angeblich nach Haldensleben entführt |
| Heide | hölzerne Spielfigur, Mitte des 18. Jhs. |
| Heidenreichstein (A) | steinerne Prangerfigur von 1688, neu aufgestellt 1955 |
| Herford | steinernes Brustbild, Mitte des 17. Jhs., untergegangen |
| Hildesheim | steinerne Brunnenfigur von 1545, als „Roland“ bezeichnet |
| Hollenburg (A) | steinerne Prangerfigur von 1591 |
| Hopen | hölzerne Spielfigur, Mitte des 17. Jhs. |
| Hostinné (Arnau) (CZ) | Wappenhalter, 18. Jh., als „Roland“ bezeichnet |
| Hoya | vermeintlicher Roland auf Rathausgiebel, ca. 18. Jh., untergegangen |
|
Ilanz (CH)
|
Fundort der Rolandmünze aus der Zeit vor 790 n. Ch. |
| Innsbruck (A) | steinerne Figur des heiligen Roland am Maximiliansgrab von 1520 |
| Iserlohn | Pankratius-Statue aus Holz von 1504, als „Roland“ bezeichnet |
| Itxassou (F) | Felsöffnung, nach der Sage von Roland geschlagen |
|
Jüterbog |
|
| Kirchen/Sieg | Roland als Kriegerdenkmal, 1930 errichtet |
| Köln | Bismarck-Roland von 1903 |
| Königsberg/Bayern | steinerne ehemalige Brunnenfigur von 1605 |
|
Korbach |
hölzerne Figur von 1366 ?, untergegangen, um 1470 als steinerne Brunnenfigur errichtet |
| Kremp | hölzerne Spielfigur, Ende des 18. Jhs., untergegangen |
| Kutná Hora (Kuttenberg) (CZ) | steinerne Prangerfigur von 1586, untergegangen |
| Laa/Thaya (A) | steinerne Prangerfigur von 1575 |
| Lauenburg | hölzerne Büttelfigur, um 1700, untergegangen |
| Leipzig | steinerne Rolandfigur als Fassadenschmuck, 1914 |
| Liberec (Reichenberg) (CZ) | kupferne Rolandfigur auf dem Rathausdach von 1892, jetzt im Museum, Wiederaufstellung geplant |
| Liepvre (F) | Roland als Paladin, Glasfenster von 1338, untergegangen |
| Limoges (F) | Roland als christlicher Kämpfer mit Pferd, Relief von 1130 |
| Litomerice (Leitmeritz) (CZ) | hölzerne Figur von 1350, untergegangen, 1539 aus Stein als „wilder Mann“ aufgestellt |
| Lübeck | hölzerne Spielfigur von 1689, untergegangen |
| Ludweis (A) | steinerne Prangerfigur von 1706 |
|
Magdeburg
|
|
| Mannheim | Nagel-Roland von 1915, untergegangen |
| Marne | hölzerne Spielfigur, Anfang des 20. Jhs. |
| Matrice (I) | Roland in der Schlacht von Roncesval, Relief von 1148, |
| Meaux (F) | Darstellung Rolands am Grabe von Ogier dem Dänen, um 1180, untergegangen |
| Meldorf | hölzerne Spielfigur aus dem 18. Jh. |
| Metz (F) | steinerner Roland mit dem Kopf von Graf Haeseler von 1908 am Bahnhof, Kopf untergegangen |
| Modena (I) | Roland als Hornbläser und Kämpfer von 1179 an der Turmfassade |
| München | Darstellung des Bremer Rolands in einem Glasfenster von 1907 |
| Münster/Westfalen | hölzerne Spielfigur aus der 2. Hälfte des 16. Jhs., untergegangen |
| Navarette (E) | steinerne Hornbläserfigur, Mitte des 14. Jhs. |
| Neustadt/Hohnstein | hölzerne Figur aus dem Ende des 14. Jhs. ?, untergegangen, 1730 neu errichtet |
| New York (USA) | hölzerne Nachbildung des Bremer Rolands von 1890 in der Zionskirche in Brooklyn |
| Nitzow | hölzerne Figur, um 1700, nicht belegbar, untergegangen |
| Nordhausen | hölzerne Figur von 1385, neu errichtet 1717, Kopie von 1993 |
| Nürnberg | steinerne Nachbildung des Bremer Roland von 1881 im Germanischen Museum, 1968 abgebrochen |
| Obermarsberg | steinerne Figur des heiligen Roland, um 1410 oder 1600 ? |
| Obihiro (J) | Nachbildung des Bremer Roland in einem Freizeitpark |
| Oebisfelde | steinerne Figur von 1523, untergegangen, neu aufgestellt 1892 |
| Perleberg | hölzerne Figur von 1498, aus Stein 1546 |
| Plötzky | hölzerne Figur von 1450 und 1750 ?, untergegangen, Errichtung eines steinernen Roland im Jahre 2005 geplant |
| Polczyn Zdroj (Polzin) (PL) | hölzerne Figur um 1400 ? erneuert 1789, untergegangen |
| Potzlow | hölzerne Figur aus dem Ende des 14. Jhs., 1727 und 1806 erneuert, Kopie von 1991 |
| Poznan (Posen) (PL) | Henkerfigur von 1535, erneuert 1969 |
| Prabuty (Riesenburg) (PL) | Brunnenfigur, 1928 aufgestellt, untergegangen ? |
| Praha (Prag) (CZ) | steinerne Figur von 1370, erneuert 1506 und 1884 |
|
Prenzlau |
|
| Puenta de la Reina (SP) | Relief von 1180 mit der Darstellung des Kampfes Roland gegen Ferragut |
| Pula (HR) | Rolandstatue mit Schwert, nicht belegbar, untergegangen |
| Pulkau (A) | steinerne Prangerfigur von 1542 |
| Quedlinburg | steinerne Figur, um 1440, zerstört 1477, aus den Resten neu errichtet 1869 |
| Questenberg | hölzerne Figur, um 1740 errichtet, erneuert 1820 |
| Quito (Ecuador) | steinerne Nachbildung des Bremer Rolands von 1978 |
| Reims (F) | Relieffigur Rolands von 1270 |
| Rheinsberg | hölzerner Roland, nur aus Sagen bekannt, untergegangen |
| Riga (LV) | hölzerne Figur von 1412, erneuert 1474, aus Stein 1896, erneuert 1999 |
| Rolandia (BR) | steinerne Nachbildung des Bremer Rolands von 1957 |
|
Rolandsbogen |
|
| Rolandsbresche (F) | Felsscharte in den Pyrenäen, der Sage nach von Roland geschlagen |
| Roncesvalles (E) | mehrere Rolanddarstellungen aus neuerer Zeit |
| Roth/Bayern | steinerne Figur von 1936 |
| Sadów (Sandow a. d. Pleiske) (PL) | hölzerne Figur aus dem 17. Jh., nicht belegbar, untergegangen |
| Saint Denis (F) | Darstellungen aus dem Rolandslied im Glasfenster, um 1140, untergegangen |
| Salamanca (ES) | Relief mit der Darstellung des Reiterkampfes Roland gegen Ferragut von 1165 |
| Salzwedel | Rolandfigur aus dem Ende des 16. Jhs., nicht belegbar, untergegangen |
| San Juan de Ortega (E) | Darstellung des Kampfes Roland gegen Ferragut aus dem Ende des 12. Jhs. |
| Sangerhausen | steinerner Kopf in der Rathausmauer aus dem 15. Jh., als „Roland“ bezeichnet * S. # |
| Satov (Schattau) (CZ) | steinerne Prangerfigur aus dem 17. Jh. |
| Schwalenberg | Rolandfigur aus Metall von 1957 |
| Schwedt | hölzerne Figur, Mitte des 14. Jhs., nicht belegbar, untergegangen |
| Sibiu (Hermannstadt) (RO) | steinerne Prangerfigur um 1700, jetzt im Museum |
| Skänninge (S) | vermeintlicher „Roland“ aus Holz, um 1500, untergegangen, 1990 neue Figur aus Metall aufgestellt |
| Soest | Patroklus-Statue aus Holz, 14. Jh., als „Roland“ bezeichnet |
| Sroda Slaska (Neumarkt) (PL) | steinerne Brunnenfigur von 1913 |
| Stendal | steinerne Figur von 1525, durch Kopie 1974 ersetzt |
| Stoky (Stockach) (CZ) | Prangerfigur, um 1500, durch eine steinerne ersetzt 1929, nichts Näheres bekannt |
| Stördorf | hölzerne Spielfigur aus dem 18. Jh. |
| Stralsund | Rolandfigur aus dem 16. Jh., untergegangen, nichts Näheres bekannt |
| Straßbourg (F) | Glasfenster, um 1200, Darstellung Rolands als Paladin |
| Tarragona (E) | Darstellung des Kampfes Roland gegen Ferragut, um 1300 |
| Templin | steinerne Figur als Fassadenschmuck, 1937 |
| Thaya (A) | steinerne Prangerfigur von 1712, erneuert 1904, als „Roland“ bezeichnet |
| Tientsin (CN) | Roland aus Metall als Kriegerdenkmal, 1905 errichtet, untergegangen |
| Tilleda | Rolanddarstellung im Gemeindesiegel, ab 1682 verwendet |
| Tondern (DK) | Büttelfigur aus dem 18. Jh., als „Roland“ bezeichnet |
| Traismauer (A) | steinerne Prangerfigur von 1584 |
| Treysa | steinerne Brunnenfigur von 1685, als „Roland“ bezeichnet |
|
Vellahn/Meckl. |
Nagel-Roland von 1915, untergegangen |
| Verden/Aller | Büttelfigur aus dem 17. Jh., nichts Näheres bekannt |
|
Verona (I) |
|
| Visby (S) | Rolanddarstellung aus dem 14. Jh., nichts Näheres bekannt, untergegangen, im 19. Jh. noch kleine Prangerfigur vorhanden, untergegangen, |
| Wedel | hölzerne Ritterfigur um 1450, durch eine steinerne Kaiserfigur 1558 ersetzt, diese wiederum 1651 erneuert |
| Weismain | steinerne Brunnenfigur von 1572, durch Kopie 1879 ersetzt |
| Weiten (A) | steinerne Prangerfigur von 1620 |
| Wiesbaden | Roland als Bühnenbild, 1899, untergegangen |
| Wildeshausen | Roland auf einer Kirchenglocke von 1448, untergegangen |
| Windbergen | hölzerne Spielfigur aus dem 17. Jh., 1932 erneuert |
| Wittenberg | steinerne Grabplattenfigur aus dem 14. Jh., als „Roland“ bezeichnet |
| Wolde | hölzerne Figur, nur aus Sagen bekannt, untergegangen |
| Wolfenbüttel | Roland als Mosaik an der Außenwand von „Karstadt“, um 1970 |
| Wroclaw (Breslau) (PL) | steinerne Büttelfigur auf einer Staupsäule von 1492, untergegangen |
| Zerbst | hölzerne Figur, vor 1385 errichtet, durch steinerne 1445 ersetzt |
| Ziesar | hölzerne Figur aus dem 15. Jh., nichts Näheres bekannt, untergegangen |
| Zittau | steinerne Brunnenfigur von 1585, durch Kopie 1891 ersetzt, als „Roland“ bezeichnet |
| Zürich (CH) | Hornbläserfigur am Großmünster, Ende des 12. Jhs. |
| Zwickau | Hauseckfigur von 1930 aus Stein, nicht Näheres bekannt |
Abkürzungen
| A | Österreich | HR | Kroatien |
| BR | Brasilien | I | Italien |
| CH | Schweiz | LV | Lettland |
| CN | China | NL | Niederlande |
| CZ | Tschechei | PL | Polen |
| DK | Dänemark | RO | Rumänien |
| E | Spanien | S | Schweden |
| F | Frankreich | SK | Slowakei |
Übersicht über die wichtigsten erhaltenen Rolande
(Eine Ergänzung und Korrektur muss noch vorgenommen werden - D. H. St.)
(nach D. Pötschke, a. a. O.)
|
|
Wie oben schon erwähnt, war an einem Pfosten des Roland-Gehäuses ein Halseisen für "Verbrecher" angebracht. Ehebrecher oder "kleinere Diebe" mussten hier zur Strafe am "Pranger" oder "Kak" für eine bestimmte Zeit stehen. Dabei waren sie den Kot- und Unrat-Würfen des Pöbels ausgesetzt. Aber auch wer sich nur gegen die strenge Trennung der sozialen Schichten verging, wurde hier hart bestraft. 1723 hatte es die Magd Marie Golitz gewagt, auf der Straße eine Baumwollschürze !!! zu tragen. Damit hatte sie gegen die städtische Kleiderordnung verstoßen und wurde mit umgehängter Schürze zu drei Tagen !!! Prangerstehen verurteilt (vgl. Reccius, a. a. O.).
 |
|
Eingemauerte Steinkugel |
Außerdem beachtenswert: In dem Torbogen-Durchgang ("Mühlentor") links neben dem Rathaus ist eine steinerne Kanonenkugel aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges halb eingemauert worden.
Spott, Überlebensfreude, "Souvenir" oder Mahnung für die Nachwelt?
Womöglich alles zusammen.