Stadtrundgang auf den Spuren der Geschichte
 |
 |
|
Marktplatz um
1850 (nach: Archiv Fam. Zähle) |
Marktplatz
2002, links der Hexenturm, rechts ockerfarbig das Tournierhaus |
1. Unseren Rundgang beginnen wir auf dem seit dem 14. Jahrhundert benutzten
Marktplatz der Stadt Calbe (vgl. auch die Stationen 2
und 4.
Zu einer Zeit vor über tausend
Jahren, als es weder elektronisches "Banking" oder "Shopping" noch ein globales
Verkehrsnetz gab, war der Marktplatz das ökonomische Herz einer Region.
Marktplätze waren gleichzeitig Kristallisationskerne für die Entstehung von
Städten und damit für die Herausbildung des sozio-ökonomischen Fortschritts
inmitten des feudal-mittelalterlichen Umfeldes.
Neben einem fränkischen Königshof sowie einer bedeutenden Kirche, in der Nähe
einer Grenzburg und an einer alten Etappen- und Handelsstraße gelegen, erlangte
der Markt von calvo bald eine große
Bedeutung.
Die Voraussetzungen für die
Entstehung einer blühenden mittelalterlichen Stadt waren gegeben
(vgl. Station 8).
Um 1160 (vgl. Reccius, Chronik..., S, 8) gewährte Erzbischof Wichmann, ein herausragender Politiker unter
den Magdeburger Erzbischöfen, Calbe die Marktgerechtigkeit und befahl, einen
neuen größeren Marktplatz neben dem alten, zu klein gewordenen zu errichten. Der
ursprüngliche, kleinere Marktplatz befand sich vor der heutigen Hauptpost
(vgl. Station 9). Der neue
Marktplatz, so wie er uns jetzt erscheint, erhielt während der Zeit der größten
wirtschaftlichen Prosperität Calbes im Mittelalter ein neues Rathaus und andere
repräsentative Gebäude. Calbe wurde somit faktisch als kommerziell und politisch
bedeutende Stadt angesehen.
Wer von Ihnen schon
einmal aufmerksam durch den Magdeburger Dom gegangen ist, der- oder demjenigen
wird an einem Süd-Pfeiler des Chores die Bronzegrabplatte Wichmanns aufgefallen
sein. Sie stammt aus dem ottonischen Dom des 10. Jahrhunderts. Das Grab
Wichmanns wurde beim gotischen Neubau 1209 bis 1363 (Türme 1520) übernommen.
 |
|
Wichmann von
Seeburg (nach:
Bronzegrabplatte im Magdeburger Dom, digital bearbeitet) |
Der 1115 oder 1116
geborene Wichmann, Graf von Seeburg, aus dem Geschlecht der Billunger betrieb
wie die meisten seiner Vorfahren eine expansive Ostpolitik gegenüber den Slawen.
Als außerordentlich treuer Vasall Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und
begeisterter Anhänger der Zentralgewalt schreckte er bei der Ausdehnung des
Reichsgebietes nach Osten unter dem Deckmantel der Heidenmissionierung auch vor
Gewalt, Vertreibung und Mord nicht zurück. Nach einer beachtlichen Karriere
übertrug ihm der Kaiser 1152 gegen den heftigen Widerstand des Papstes das
Erzbistum Magdeburg. Als Initiator des 1188 kodifizierten "Magdeburger
Stadtrechts" schrieb Wichmann europäische Geschichte. Dieser Erzbischof, der
viele Kriege führte und für seine Auffassung vom Christentum - wie ein großer
Teil seiner zeitgenössischen Standesangehörigen - viel Blut vergoss, war aber
andererseits ein bedeutender Förderer der Städte und ein zu Kompromissen
bereiter Politiker. So vermittelte er immer wieder - auch erfolgreich - im
päpstlich-kaiserlichen Streit und im Staufer-Welfen-Konflikt.
(In den Kriegen zwischen
Staufern und Welfen wurde Calbe zweimal völlig zerstört. Auf seinen
Rachefeldzügen brannte Heinrich der Löwe am 6. November 1179 Calbe nieder und
verheerte das Land von Halberstadt bis Frohse.)
Erzbischof Wichmann
war der kaiserliche Unterhändler im Frieden von Venedig.
Dieser zwiespältige, aber auf
alle Fälle sehr bedeutende Politiker des Mittelalters hielt sich wie viele
andere nach ihm folgende
Magdeburger Erzbischöfe oft in Calbe auf (wahrscheinlich im ehemaligen
Königshof und im
Kloster Gottes Gnade) und hat dadurch die Stadt
erst richtig ins Licht der politischen Öffentlichkeit gestellt. Dem damals sehr einflussreichen Kloster "Gottes Gnade"
(heute Gottesgnaden) (vgl. Station 12)
bei Calbe schenkte er zwei von einer Pilgerfahrt nach Palästina
mitgebrachte Reliquien der Heiligen Victor und Pontianus. Während dieser nicht
ungefährlichen Reise war Wichmann zeitweilig sogar in sarazenische
Gefangenschaft geraten
(vgl.
Lexikon
des Mittelalters: Band VI Spalte 71 - Erzbistum Magdeburg).
Er starb am 25.8.1192
in Könnern bei Bernburg. Seine Grabstelle ist, wie schon oben erwähnt, im
Magdeburger Dom.
Im Hintergrund des neuen
Marktplatzes steht der die Stadtsilhouette mit prägende so genannte Hexenturm.
Ursprünglich war dieser Turm Teil des Befestigungssystems der Stadt
(vgl. Station 15) und wurde 1480 erstmals erwähnt (1486 bereits als
Gefangenenturm). Als er 1775 als Färbereimanufaktur eingerichtet und der obere
Teilen abgerissen werden sollte, entschied sich der Magistrat für seine
Erhaltung, weil dieser Turm eine weit sichtbare Zierde der Stadt, seine
Wetterfahne der Wettervorhersage und bei Feuersbrunst diene und weil der Turm
noch in sehr gutem Zustande sei. Dieser Entscheid war gut und richtig. Bald
darauf beherbergte der Turm das Stadtarchiv.
 |
|
Hexenturm von
der Nordostseite aus gesehen |
Unser Hexenturm, der weithin zu sehen ist und den es oft auch als "Marter"- oder
"Schreckensturm" in vielen älteren Städten gibt, ist Zeuge eines der düstersten
Kapitel in der europäischen Kulturgeschichte.
Ausgerechnet beim Übergang vom "finsteren" Mittelalter zur "aufgeklärten"
Neuzeit trat eine kollektive Hysterie auf, die sich in der Verfolgung und
physischen Vernichtung angeblich vom Teufel besessener Frauen, aber auch Männer
und Kinder äußerte. Hunderttausende fielen seit dem Ende des 16.Jahrhunderts in
Europa und den europäischen Kolonien nach entsetzlichen Folterqualen dem
kollektiven Irrsinn zum Opfer.
Eigentlich gehen die Hexenverfolgungen
auf das Vorbild aller totalitären Regimes, auf das Modell jeglicher
Verfolgungsgesellschaften zurück, auf die
Inquisition.
Diese trat in zwei Wellen auf und zwar
jedes Mal, wenn sich Krisen im System abzeichneten. Während "moderne" Systeme in
Krisenzeiten auf Reformen setzen, kannte das vom Katholizismus geprägte
Feudalsystem in erster Linie Repression und Schrecken.
Die erste Welle begann, als Abtrünnige
und Abweichler von der kirchlichen Lehre auftraten, so genannte Katharer
(Reine), woraus das volkstümliche Wort Ketzer entstand. Um herauszubekommen, wer
zu den Katharern, Albigensern und Waldensern gehörte, wurde die Methode der
Befragung (Inquisition) der Verdächtigen eingesetzt. Immerhin war die Befragung
ein großer Fortschritt gegenüber der im frühen Mittelalter gebräuchlichen
Gerichtsmethode des Gottesurteils (Zweikampf, Wasserprobe, Feuerprobe usw.).
Erst als Papst Innozenz IV. die Folter zur Unterstützung der Befragung
sanktionierte, wurde das Ganze zur unmenschlichen Injurie. Insgesamt aber ging
die Inquisition in dieser ersten Etappe nicht über den im Mittelalter üblichen
Grad der Grausamkeit hinaus, verhältnismäßig wenige Todesurteile wurden gefällt.
Als 1478 mit der berüchtigten
spanischen Inquisition die zweite
Etappe einsetzte, kannten Unmenschlichkeiten in der Zeit des europäischen
Humanismus kaum noch Grenzen. Allein einer der Inquisitoren (Torquemada) brachte
es in den 11 Jahren seiner Tätigkeit auf 2000 Hinrichtungen (Würgeeisen,
Scheiterhaufen oder beides).
Doch im Laufe der Zeit zog sich die
europäische Kirche mehr und mehr aus dem schmutzigen "Geschäft" zurück und
überließ den Fürsten und ihren Beamten die "Befragungen". Die Inquisition wurde
der Staatssicherheitsdienst in der Zeit der Reformation und Gegenreformation, in
der Zeit des Kampfes zwischen Orthodoxie und naturwissenschaftlicher Weltsicht.
1487 schrieb der deutsche Dominikanermönch und Inquisitor Heinrich Kramer („Institoris“)
unter Mitwirkung des Dominikaners Jacob Sprenger ein Buch zur Bekämpfung der
Hexen, "Malleus maleficarum" (Hexenhammer), "das verrückteste und dennoch
unheilvollste Buch der Weltliteratur“. Es war eine Gebrauchsanweisung zur
brutalen "Befragung" einer, wie Kramer meinte, besonderen Gruppe von Ketzern,
den Schadenszauberern, den Behexern. Dabei dachte er wie viele seiner
Glaubensbrüder aufgrund einer starken Körper- und Sexualitätsfeindlichkeit der
damaligen herrschenden Kirchenideologie in erster Linie an Frauen. Nicht ohne
Grund ist einer der abschreckend wirkenden Wasserspeier-Satansdämonen an der
St.-Stephani-Kirche mit weiblichen Körperattributen ausgestattet. Folgerichtig
waren auch 80 Prozent der Beschuldigten Frauen. Kramer ging von einer
Verschwörungstheorie aus, dass die Klimaverschlechterung, die Naturkatastrophen
und Seuchen sowie die Unsicherheit durch soziale Umwälzungen von einer Sekte der
Schadenszauberer verursacht würden.
|
 |
|
Vor der
Verbrennung |
Aber erst ca. hundert Jahre nach diesem
pathologischen Buch, in der Krise des Feudalismus am Ende des 16. bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts, kam es zum vollen Ausbruch des Wahns. Dabei wurden nicht
nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder, nicht nur Angehörige der Unter-,
sondern auch der Oberschichten auf grausame Weise durch die staatlichen Organe
mit Duldung nicht nur der katholischen, sondern auch der protestantischen Kirche
vernichtet. Papst Johannes XXII. hatte die Anwendung der Ketzerprozesse auf die
Schadenszauberer sanktioniert. Bei den Prozessen wurde durch "Besagungen"
(Beschuldigung weiterer Menschen unter der Folter) ein regelrechtes
Schneeballsystem aktiviert.
Erst ein Jesuit, Friedrich von Spee
(1591 - 1635), war es, der, selbst unter Gefahr, gegen die Irrationalität der
Hexenprozesse und der Folter mit seinem Buch "Cautio criminalis" (1631) zu
Felde zog.
Während des Abklingens des Hexenwahns im
18. Jahrhundert wurden in allen deutschen Städten die meisten Hexenprozessakten
vernichtet. Nur durch Zufall und wahrscheinlich durch Unachtsamkeit der Beamten
blieben uns die Namen von einigen in Calbe auf dem Scheiterhaufen hingerichteten
Schadenszauberern erhalten.
Aus einer Lohnrechnung für den Henker
und seinen Gehilfen, der das notwendige Brennholz beschafft hatte (vgl.
Hertel, Geschichte..., a. a. O., S. 98), wissen wir,
dass im Jahre 1381 eine gewisse Bete Peckers auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurde. Der Name "Bet(h)e" weist auf eine "weise Frau" hin, also
auf eine heilkundige Beschwörerin der Naturkräfte. Die Bethen, deren Name auf
keltische und germanische Muttergottheiten zurück geht, waren Bewahrerinnen des
Wissens aus alten Zeiten, das besonders dem Klerus ein Dorn im Auge war. Nahe
bei Calbe gab es zwei Kultplätze aus der Frühzeit, deren Name bis in unsere Zeit
erhalten blieb: der Mägdesprung im Norden und die Wunderburg (Trojaburg) im
Süden. Vielleicht haben dort als Bethen bezeichnete Frauen geheime kultische
Handlungen vollzogen. Als sich im 14. Jahrhundert das Klima mit dramatischen
Folgen für die Menschen verschlechterte ("Kleine
Eiszeit"), gehäufte Missernten, Hungersnöte, Pest, Sturmfluten an den Küsten
und Erdbeben in Südosteuropa hereinbrachen, gab man den alten "Kontaktpersonen"
zu den Naturkräften, den Bethen, die Schuld. Später setzte sich der Name "Hexe"
(von althochdeutsch "hagzissa" = auf dem Zaun sitzende Dämonin) durch. Es kann
aber auch sein, dass die Bete Peckers eine (Elisa-)Bethe, eine Elisabethin, also
eine Schwester aus der in Calbe tätigen Beginengemeinschaft (s. Station 10) war.
Auch die Beginen wurden gegen Ende des 14. Jahrhunderts wegen ihres alten
Heilkundigenwissens und ihrer demokratischen Lebensweise verfolgt und in einigen
Fällen auch verbrannt.
In den zweihundert Jahren des Hexenwahns wurden
in Deutschland
etwa 100 000 "Hexen" getötet, in Calbe sicher Dutzende.
Während der sich über 2 Jahrhunderte
hinziehenden Obsession waren die irrwitzigen "Hexen"-Tötungsaktionen nicht in
gleichmäßiger Intensität verlaufen, sondern parallel zu emotionellen Belastungen
durch soziale und wirtschaftliche Erschütterungen.
Anklagepunkte konnten sein:
Mitgliedschaft in einer
Teufelssekte,
Fahrt durch die Luft,
Verwandlung in Tiergestalten,
Tötung von Ungeborenen im
Mutterleib,
Herstellung von "Hexensalbe" aus
Kinderleichen,
Geschlechtsverkehr mit Teufeln und
Dämonen,
Verbreitung von Hass und
Zwietracht,
Aufstachelung zur Wollust
usw. usw.
Zu den „Indizien“ zählten:
Häufiger
sowie mangelnder Kirchenbesuch und sicheres Auftreten gleichsam als
augenfällige Verteidigung,
Aufenthalt auf einem Feld vor einem
Unwetter,
Verwandtschaft oder Freundschaft
mit einer bereits verurteilten Hexe,
ein schlechter Ruf,
Hexenmale (d. h. unempfindliche
Körperstellen als Zeichen der Teufelsverbundenheit),
geringes Körpergewicht,
rote Haare usw.
|
 |
|
Massenverbrennungen |
Eine dieser
vermeintlichen Hexen ist in der Erinnerung der Geschichte Calbes lebendig
geblieben.
Der Hexenprozess war im Jahre 1634,
die Frau hieß Ursula Wurm.
Sie war als Schwester im
Heilig-Geist-Hospital tätig und mit dem Spital-Aufseher verheiratet. Das
Heilkräuterwissen dieser Frau und ihre Tätigkeit erinnerten die Menschen
wohl an die zwei Jahrhunderte zuvor von dort wegen "Ketzereiverdachts"
vertriebenen Beginen. Bald traten mehrere Zeugen auf, darunter auch ein
Pfarrer, die Ursula Wurm der aberwitzigsten Teufels-Vergehen beschuldigten.
Die grausame Mühle eines
Hexen-Prozesses setzte sich für Ursula Wurm in Bewegung, aus der es in den
meisten Fällen kein Entrinnen mehr gab.
Das
vorgeschriebene Prozessverfahren im 17. Jahrhundert, das den Anschein von
korrekter Vorgehensweise erwecken sollte:
-
Gütliches Verhör
-
Vorbereitende Vernehmung, Frage nach Lehrmeistern, Zaubermitteln und
Namen von Komplizen. Da hier verständlicherweise meist keine Aussagen
kamen, wurde das als Verstocktheit gedeutet.
-
Peinliches Verhör
-
Übergabe der Anklage durch einen öffentlichen Ankläger, Wahl eines
Beistandes, Zeugenverhöre, Resümee des Anklägers und der Verteidigung.
-
Gutachten einer juristischen Behörde
-
meist einer Landeskanzlei. Im Falle der U. Wurm war das der
erzbischöfliche Schöffenstuhl in Halle.
-
Erkundung mittels Tortur
-
nach entsprechender Entscheidung der juristischen Behörde. Die Folter und
verschärfte Folter wurde durch den Scharfrichter (Henker) und seinen Gesellen
durchgeführt, deren grausamer Phantasie dabei keine Grenzen gesetzt waren.
-
Das Urteil
-
musste durch den Landesherren, in unserem Falle durch den Erzbischof,
bestätigt werden.
-
Vollsteckung
-
Verbrennen bei lebendigem Leibe, gefesselt an einen Pfahl, während
die Flammen sich ringsherum entfalteten, bzw. an eine Leiter, die in die schon
lodernden Flammen gekippt wurde,
-
oder nach vorherigem Erdrosseln.
-
Für Schadenszauberer (Hexen) und für Brandstifter war die
Hinrichtungsform der Verbrennung vorgesehen.
|
Aus den
Akten des Hexen-Prozesses gegen Ursula Wurm aus Calbe an der Saale
(nach Hertel, Geschichte…, a. a. O.,
S. 99 ff.):
„Weil denn die ganze
Bürgerschaft und das würdige Ministerium [so wurde die Geistlichkeit
genannt] ihr [der U. Wurm] ein böses Zeugnis geben, sie auch selber,
als sie in Verhaft gebracht werden sollen, sich verlauten lassen,
wenn sie sterben sollte, sie noch andere mehr
namhaftig machen wollte, so wird sie
deswegen mit Ernst umständig gefragt.
Und da [wenn] sie in der
Güte nicht bekennen würde, mag sie in der scharfen Frage, jedoch
menschlicher Weise, angegriffen werden.“
Nachdem sich der Henker und
seine Gesellen von der „menschlichen Weise“ zur immer „schärferen
Frage“, der verschärften Tortur, gesteigert hatten, gab es für
Ursula Wurm nur einen Gedanken: das Ende der Qualen. Nach
stundenlanger Folter durch Strecken, Gliederzerquetschen,
Rippenzerbrechen und Brennen mit glühenden Eisen gab die gemarterte
Frau alles, was die Herren hören wollten, zu Protokoll.
„Frage l:
Woher sie die Zauberei gelernt?
Antwort: Vom Teufel.
2. Wie lange sie solche
gekonnt?
Sie hätte solche nur ein
Jahr gekonnt.“
„Als ihr vorgehalten wurde,
daß sie des Meisters Schabach Kind schon vor sechs Jahren bezaubert,
sagte sie, daß sie über sechs Jahre solcher Händel kundig sei.
3. Wem sie Schaden getan?
- Hätte die beiden
Klägerinnen und die Mayerin nebst ihrer Tochter bezaubert, und wäre
solches geschehen, als dieselbe krank gewesen und von ihrer
Mitschwester wäre gewartet worden. Ingleichen hätte sie Jakob
Schabachs Töchterlein bezaubert, auch demselben die Zauberei wieder
benommen, als der Vater so heftig auf sie eingestürmt.
4. Was sie zu ihrer
Zauberei gebraucht?
Hätte Kraut dazu gebraucht,
hieße Anbetica, wie sie es nennet, solches habe sie hinter die Leute
gestreuet und gesagt: >Da hast du es in Teufels Namen<, worauf denn
die Zauberei bei den Leuten, so sie zu bezaubem Lust gehabt,
gehaftet. Welches sie denn auch an ihrer Anklägerin und an Meister
Schabachs Töchterlein vor sechs Jahren praktizieret.
5. Ob sie mit dem Bösen
einen Kontrakt oder Pakt geschlossen?
- Ja, vor sechs Jahren. Er
hätte ihr 4 Groschen daraufgegeben, so zwar, als sie solche ausgeben
wollen, ungültig gewesen. Er hätte ihr auch zugesagt, sie zu
versorgen und zu behalten. Hiergegen hätte sie sich auch müssen
gefallen lassen, ihm unterthänig zu sein und seines Willens zu
pflegen. Wie sie denn auch aus drei unterschiedenen coctibus" [sie
meinte hier den Geschlechtsverkehr mit dem Satan] „fünf Paar böse
Dinger von ihm gezeugt, welche sie auch zur Zauberei gebraucht.
6. Wer mehr solcher Händel
sich sonst befleißiget? Wüßte keinen mehr als:
l.
Agnese
Künnemann, ihre Mitschwester, welche die Anklägerin und ihre
Tochter hätte mit bezaubern helfen und mehr als sie dabei
gethan. Auch die selige
Gebhartin hätte sie,
ohngeachtet sie viel Gutes von ihr
genossen, doch so bezaubert, daß sie mit Ach und Weh ihren Geist
habe aufgeben müssen.
2.
Sara Lachsin, auch ihre
Spittelschwester. Hätte viele Leute
und besonders Hansen Bräutigam nebst seiner Schwester bezaubert.
Dieses hätte sie von ihr selbst gehöret. Denn als jener Hans
Bräutigam nebst seiner Schwester einmal vor der
Spittelthüre vorbeigegangen, hätte die
Lachsin, die bei ihr gestanden, gesagt: Pfui - und darauf hinter ihm
gespuckt und die Worte gebraucht: >habe ich
dirs noch nicht genug gethan, so
woll ichs dir alter Schelm noch besser
machen und deiner schwarzen Agnese daneben<. Darauf wären beide
bezaubert worden und hätten des Todes seyn
müssen.
3. Anna Hebenstreit. Sie
wüßte zwar von ihr keine eigentliche Zauberei, aber sie wäre
vergangene Walpurgis-Nacht
mit ihr auf dem Blocksberge [Brocken] gewesen und zwar noch zeitiger
als sie.
4. Ihr eigener Mann. Der
könne zwar nicht viel, hätte aber doch vor acht oder neun Wochen
ungefähr ein Weib bezaubert.“
(vgl. Hertel, Geschichte..., a. a. O.,
S. 101 f.)
Diese Personen wurden durch die "Besagungen" der Ursula Wurm
ebenfalls verhaftet und gegen sie das „Verfahren“ eröffnet. Über
deren Prozesse blieben keine Akten erhalten. Es ist aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch sie bei der Art der
Befragungen alles „gestanden“ haben und verbrannt wurden.
Nach Verlauf einiger Wochen kam das Endurteil der Ursula Wurm vom
Schöffenstuhl in Halle, der vorgesetzten Behörde, die zu der Zeit
unter schwedischer Herrschaft stand, und am 10. Juli 1634 wurde sie
zur außerhalb der Stadt gelegenen so genannten Radelbreite (heute
etwa beim Ärztehaus im Norden der Stadt) gefahren und dort zur
Ergötzung und "Abschreckung" des Pöbels und der Bürger öffentlich
verbrannt (vgl. ebenda, S. 102 f.) |
Auch nach dem 1680 erfolgten
"Beitritt" des Magdeburger und damit des calbischen Gebietes zu
Brandenburg-Preußen wurden diese Hexenverfolgungen und -hinrichtungen nicht
sofort unterbunden. Noch 1688 wurde der lahme Schneider Michael Stoppel
wegen Teufelspaktes den Flammen übergeben (vgl. ebenda, S. 103).
1715 wurde die Brandsäule auf Befehl
des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. beseitigt (vgl.
Reccius, Chronik..., a. a. O., S. 67).
Die letzte Hexenverbrennung
in Deutschland
fand wahrscheinlich um 1750 statt
(vgl.
HEXENFORSCHUNG archives
21.6.2004-http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0406&L=hexenforschung&O=D&F=&S=&P=1568).
Maria Schwägeli, eine arme
Bauernmagd, gilt als die
letzte Frau, die im deutschen Bereich als "Hexe" angeklagt und am 11. April
1775 in Kempten (Allgäu) enthauptet worden war. Nach neueren
Forschungen ist sie jedoch schon vorher verstorben
(vgl.
http://www.oehring.net/hexenbruch/04.html).
Anna Göldi, die s. g. „letzte
Hexe Europas” wurde 1782 im schweizerischen Glarus mit dem Schwert
hingerichtet. Eventuell gab es aber in Posen noch 1792 eine
Hexenhinrichtung.
Ursula Wurm blieb als
die "Hexe" aus Calbe in Erinnerung, obwohl es vor und nach ihr andere
Unschuldige gab, die wegen unsinniger religiös verbrämter Behauptungen
gefoltert und verbrannt worden waren.
Nach modernen
Forschungsergebnissen wurden die Hexenprozesse im deutschen Bereich
besonders intensiv und grausam geführt.
Ein Vergleich zu
späteren finsteren Zeiten in Deutschland drängt sich auf. Überheblichkeit
gegenüber den Menschen an der Schwelle zur Neuzeit ist nicht angebracht.
Vergessen wir nicht: Massenhysterie und die Bereitschaft zur
Menschenvernichtung waren auch in den folgenden Jahrhunderten, besonders im
zwanzigsten, hier in Deutschland möglich.
Interessant ist auch das
Gebäude Nr. 14, das Haus der französischen Einwandererfamilie Tournier aus dem
18.Jahrhundert. Wie man an dem imposanten Haus deutlich sehen kann, hatten es
die Tourniers zu erheblichem Wohlstand gebracht.
 |
|
Das 1747
erbaute Haus der
bedeutenden hugenottisch-französischen Tuchfärber- und Kaufmannsfamilie von Jean
Tournier |
Durch welche Umstände aber waren diese Leute ausgerechnet nach Calbe gekommen?
Im
katholischen Frankreich wurden die calvinistisch-protestantischen
Hugenotten brutal verfolgt. Die preußischen Könige
versuchten ihr rückständiges Land mit Hilfe der französischen Verfolgten zu
sanieren. Als durch das Edikt von Fontainebleau Ludwigs XIV. am 18.10.1685 das
tolerante Edikt von Nantes (von 1598) wieder aufgehoben wurde und die französischen
reformierten Protestanten erneut verfolgt wurden, erließ Kurfürst Friedrich
Wilhelm schon am 8.11.1685 in Preußen das
Potsdamer Toleranzedikt, in dem allen preußischen Untertanen
Glaubensfreiheit und fremden Einwanderern mit wichtigen Berufen eine Reihe von
Fördermaßnahmen und Vergünstigungen zugesichert wurden. Bald darauf wurden
20 000 hugenottische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich und der Pfalz in weiten
Teilen Preußens, auch in Calbe, angesiedelt.
Noch einige Worte zu den Pfälzern,
die in unserer Gegend eine große Rolle spielten und manchmal "Wallonen" genannt
wurden:
In das an Frankreich
grenzende Kurfürstentum Pfalz hatten sich im 17. Jahrhundert viele Hugenotten
geflüchtet, weil Karl Ludwig, der Sohn des unglückseligen "Winterkönigs von
Böhmen", im Westfälischen Frieden 1648/49 die Pfalz erhielt und sie mit
religiöser Toleranz und geistiger Aufgeschlossenheit regierte. Hugenotten wurden
mit Privilegien ausgestattet und brachten das Kurfürstentum rasch zur
kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis
1697 jedoch erhob Ludwig XIV. von Frankreich Anspruch auf das prosperierende
Gebiet. Bald sah sich der Sonnenkönig aber einer Großen Allianz von Kaiserreich,
England, Spanien, Niederlanden und Savoyen gegenüber. Auf seinem Rückzug wandte
er in der Pfalz die "Taktik der verbrannten Erde" an, um vom frühkapitalistisch
blühenden Land auch seinen Gegnern nichts zurückzulassen. Die Urheber des
Wohlstandes, die inzwischen fast schon "eingedeutschten" Hugenotten, flohen in
Scharen. Da reagierte der preußische Kurfürst am 8.11.1685 prompt (siehe oben),
und die "Pfälzer" fanden in Brandenburg-Preußen eine neue Heimat. (Übrigens: Auch der Gründervater der späteren Magdeburger Grusonwerke, Abraham
Gruson, war ein Pfälzer Emigrant.)
 |
|
Stuckarbeiten und Gemälde "Perseus
befreit Andromeda" im 1. Stock des Tournierhauses |
1687 wurden auf Anordnung des
Großen Kurfürsten (Privilegium vom 23.12.) in Calbe sieben pfälzische Tuchmacher
angesiedelt. 1709 kamen die ersten französischen Protestanten, die
hugenottischen Refugiés hierher. 1732 existierten 19 französische und 44
pfälzische Familien in der Stadt. Diese ersten Aussiedler der Neuzeit in Calbe
wurden in einer eigenen "Kolonie" am inzwischen zugeschütteten nördlichen
Stadtgraben (der heutigen Grabenstraße, früher "Koloniestraße")
(vgl. Station 10) angesiedelt und
bestimmten fortan die Geschicke der Stadt maßgeblich mit. Sie waren hier
vorwiegend als Tuchmanufakturisten tätig. Tuch aller Art brauchten die
Preußenkönige vor allem für Uniformen und das gestiegene Modebewusstsein von
Adel und Bürgertum.
Der 1723 nach Calbe gekommene junge Refugiè und
Tuchfärbermeister Jean Tournier
trug wesentlich zur Steigerung der calbischen Tuchproduktion bei und wurde
einer der angesehensten und wohlhabendsten Bürger der Stadt (siehe
Rahmen weiter unten).
Die französischen
Auswanderer brachten auch das entsprechende technische Know-how mit, und nicht
nur das, sie übermittelten auch eine neue Kultur, welche die Preußen noch nicht
kannten: z. B. die "Bock"wurst, die Boulette, den Blumenkohl, einige
Gewürzsorten, die Soße, die Gabel, den Friseur, die Mode, das Parfüm, die
Reinlichkeit, gute Manieren, und ... und ... und, kurz: eine neue, bessere
Lebensqualität.
Aus den Reihen ihrer
hugenottischen Vorfahren gingen auch bedeutende "preußische" Dichter und Denker
hervor, Theodor Fontane war nur einer von
ihnen.
 |
|
Stuck über einem Kamin im Tournierhaus |
Ihren reformierten Glauben
durften die Neubürger in der ehemaligen Schlosskapelle ausüben.
 |
|
Klassizismus-Türrahmen (möglicherweise
von den Grobes) im Haus Markt 14 |
Die Spannungen
und Streitigkeiten zwischen den reformierten protestantischen Einwanderern und
lutherischen protestantischen Alteingesessenen waren nur die Äußerlichkeiten für
eine tiefer sitzende ökonomische Rivalität. Auch Pfälzer und französische Neubürger traten
untereinander anfänglich noch als Kontrahenten auf. Die hugenottischen Einwanderer, die etwa ein
Achtel der Bevölkerung des 18.Jahrhunderts in Calbe ausmachten, sind bald mit
der Calber "Ur"bevölkerung verschmolzen, manchmal trifft man noch auf ihre,
oftmals eingedeutschten Familiennamen.
Hier die
Geschichte des bedeutendsten calbischen Hugenotten Jean Tournier:
|
Der 1664 geborene Vater, der auch Jean hieß, stammte
aus Beaurepaire (zwischen Lyon und Grenoble) im Dauphiné (heute Isère). Er schloss sich dem „Exulanten“-Strom
der etwa 50.000 Hugenotten von 1685 an, von denen sich 20.000 nach
Brandenburg-Preußen wandten, weil der „Große Kurfürst“ Friedrich
Wilhelm am 29. Oktober das Toleranz-Edikt von Potsdam erlassen
hatte, das den französischen Glaubensbrüdern Sicherheit und
Förderung durch Privilegien zusicherte.
|
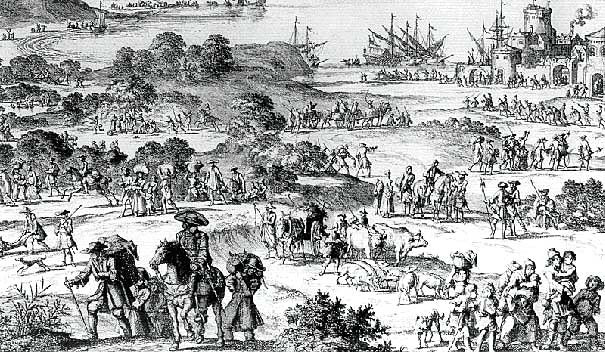 |
|
Exulanten-Strom (Jan Luyken 1696) |
Ende 1685 oder Anfang 1686 kam der 21-jährige Jean
Tournier nach Dessau. Wenig später heiratete der Maitre Teinturier
(Färbermeister) hier die Dessauerin Irene Marie Anthonis.
Am
23.01.1698 wurde in Dessau der Sohn Johann (Jean) geboren.
Um 1700
siedelte die Familie nach Halle/Saale über. Dort wurden die Kinder
Pierre (1703), Marthe llsbeau (1706), Esther (1708), Jeanne Marie
(1710) und Jaque (1713) geboren. Seit 1710 wurde Jean Tournier in
den Akten auch als Marchand (Kaufmann) bezeichnet, ein Zeichen
dafür, dass ihm der für den weiteren Aufschwung der Familie wichtige
Sprung vom Spezial-Handwerker zum Handelskapitalisten gelungen war.
Der älteste Sohn Johann (Jean), der bei seinem Vater
das Tuchfärberei-Handwerk - und wohl auch die Kaufmannsgeschäfte - erlernt hatte, heiratete nach 1720 Anna
Dorothea Rotter. Das Paar zog 1723 nach Calbe, wo 1726 das erste Kind
geboren wurde. Hier begründete Johann Tournier eine Waid- und
Schönfärberei für Tuche, ein bis dahin in Calbe unbekanntes
Spezialhandwerk. 1729, also nur ganz wenige Jahre nach seiner Ankunft
in Calbe, wurde er bereits als Handelsmann und
Gerichtsassessor (später auch „Kolonie-Gerichtsassessor“)
bezeichnet. (Nach
genealogischen Forschungsergebnissen von Herrn Roland Hiller aus
Edemissen, einem Nachfahren der französischen Familie Tournier)
Mit „Kolonie“ war die hugenottische Siedlung nördlich
der heutigen Grabenstraße mit ihrem eigenen Gotteshaus in der
Schlosskapelle gemeint. Wie seine Titel zeigen, hatte auch der junge
Jean den Sprung in die kapitalkräftige Oberschicht geschafft.
1737 begründete er mit Joachim Gerhard Ritter, einem
Pastorensohn aus Quedlinburg, eine Flanellmanufaktur mit dem Recht
des Tuchverlages. Das heißt, Ritter und Tournier durften Wolle und
Rohtuche einkaufen, die Wolle an ärmere Tuchmacher zum Weben, Walken
und Scheren weitergeben und die Tuche nach Verrechnung der
Rohstoff-Auslagen gegen ein (nicht sehr erhebliches) Entgelt von den
Handwerkern wieder abkaufen (vgl. Reccius,
Beiträge zur Geschichte der Tuchmacherei..., S. 20).
Die Ärmeren unter den calbischen Webern - etwa 80
Prozent - waren so auf
den Weg ins Lohn-Proletariat geraten. Unruhen und Protestbriefe an
die preußische Regierung in Magdeburg zeigten, dass die Kaufleute
nicht gerade zimperlich bei der Jagd nach Profit mit den ärmeren
ihrer Handwerks-"Kollegen" umgingen.
In der Ritter-Tournier-Manufaktur wurden Rohtuche
veredelt, in erster Linie gefärbt. Aus den Akten ist zu ersehen,
wie die Handwerksmeister realistischerweise auch eingestanden, dass die manufakturell
erzeugten Tuche von Tournier und Ritter qualitativ hochwertiger als ihre eigenen waren (vgl.
ebenda).
Jean Tournier wurde so reich, dass er sich am Markt
(Nr. 14) eines der prächtigsten Häuser in Calbe erbauen konnte,
dahinter 1742 eine neue große Färberei. Er "erwarb weiterhin noch
vier Häuser und steckte Kapital in andere Unternehmungen. Während
des 7jährigen Krieges schoß er der Stadt 1000 Taler [heute ein
Millionen-Betrag - D.H.S.] zu der vom König befohlenen Zwangsanleihe vor." (Ebenda).
1769 starb seine Frau Anna Dorothea.
Die 1729 in Calbe geborene Tochter Regina Charlotta
heiratete 1746 Johann Ursinus, einen Kaufmann aus Leipzig.
(Nach
genealogischen Forschungsergebnissen von Herrn Roland Hiller aus
Edemissen, einem Nachfahren der französischen Familie Tournier)
1759 (oder 1769? - D.H.S.) setzte sich Jean Tournier zur Ruhe,
wohnte später in der Scheunenstraße 26, wie Einquartierungsnotizen
aus der Zeit der friderizianischen Kriege (vgl.
Station 18) belegen (vgl.
Reccius, Chronik..., a. a. O., S. 80),
und überschrieb das Geschäft, aus dem sich sein Kompagnon Ritter
bereits zurückgezogen hatte, seinem Enkel Johann Friedrich Ursinus.
Dessen Witwe, die Ritter-Tochter Wilhelmine Charlotte, verheiratete
sich in zweiter Ehe mit dem Kaufmann Bernhard Grobe aus Bernburg,
der das Geschäft weiterführte und 1780 das großartige Tournier-Haus
am Markt erwarb (vgl. ebenda).
1791 starb
der Schönfärber und Tuchhändler Jean Tournier im Alter von 93 Jahren. Er war
hier in Calbe zu einem sehr reichen und angesehenen Mann geworden, der von
seinem Vermögen dem Pfarrer der reformierten Gemeinde ein Haus in der
Tuchmacherstraße/Ecke Grabenstraße geschenkt und in der Stadt eine Vielzahl von
bürgerlichen Funktionen innehatte (vgl. ebenda).
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die
Entwicklung Calbes im 18. Jahrhundert zum herausragenden
Tuchproduktionszentrum zu einem großen Teil diesem bedeutenden
Mann zu verdanken ist. |
|
 |
|
Ehem. Tournier-Haus und
später zeitweilig das Landratsamt, Scheunenstraße 26 |
Informationen über das inzwischen beseitigte
unechte Erbbegräbnis der Tourniers auf dem Laurentiusfriedhof erhalten Sie an
der Station 20.
Die Grobes wurde neben den
Nicolais die bedeutendste und einflussreichste Tuchfabrikanten-Familie des 19.
Jahrhunderts in Calbe, deren Wirken bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts
reichte.
 |
|
Handgemalte Urkunde von 1896 über die
Verleihung des Prädikats "Stadtältester" an
Eduard Grobe, der seit 1872
Wollwarenfabrikant in Calbe war. Seine bedeutende Fabrik befand sich in
der Tuchmacherstraße. Als Motto steht das Schiller-Zitat zu lesen:
"Arbeit ist des Bürgers Zierde." Ganz dem neuen imperialen Gefühl
entsprechend, links die gewappnete und planende Germania. Oben: das
neue Rathaus, unten: die neue Prinz-Wilhelm-Brücke. Die Putten auf der linken Seite schütten
übrigens Calber "Bollen" aus. (Reproduktion nach dem Original in der
Heimatstube) |

