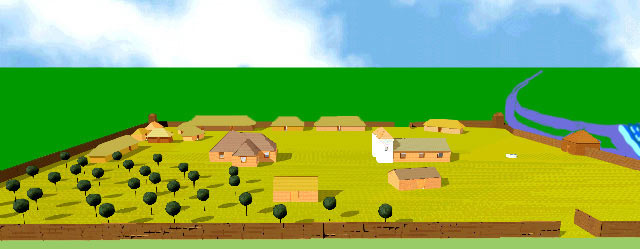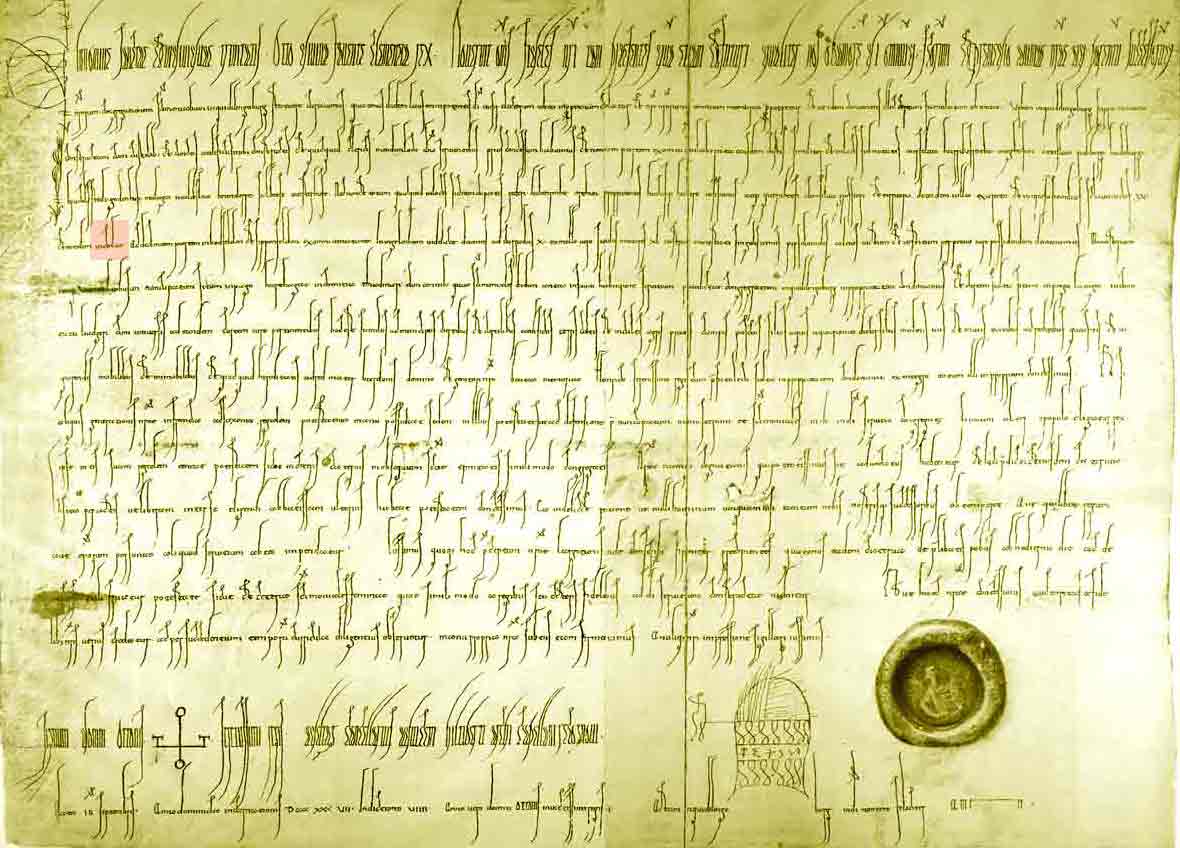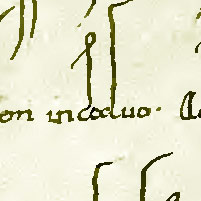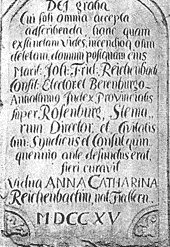8. In der Ritterstraße (ehemals:
"Herrengasse") auf der Westseite - hinter der ehemaligen
Volksschule (vgl. Station 7) - befand sich ein
Rittergut. Das
Herrenhaus existiert noch. Vor 50 Jahren waren hier am Türportal ein Wappen
der Ritter von Ha(c)ke und eine Inschrift zu sehen.
Dieses ehemalige
Rittergut steht auf einem Gelände, wo in etwa im 9.Jahrhundert der "Königshof" zu finden war.
K. Herrfurth hat Indizien dafür gefunden, dass sich das Zentrum des Hofes ca.
220 Meter weiter südlich, an der heutigen Kuhgasse befand (s. drittfolgender
Absatz).
Diese Königshöfe bildeten die
wirtschaftliche Grundlage des Königtums. Der nächste Königshof von Calbe aus
liegt in Frohse. Im mittelalterlichen Deutschland gab es noch keine Hauptstädte.
Die Könige, auch die Kaiser, zogen von einem Wirtschaftshof zum anderen, wobei
sie meist in den Wintermonaten dort blieben und im Sommer mit einem großen
Hofstaat und vielen Bewaffneten reisten. So wurden einige Königshöfe auch zu
politischen Zentren, sie wurden besonders ausgebaut, und die Pfalzen entstanden.
Natürlich hatten die Könige auch Lieblingspfalzen, wo sie sich besonders gern
und öfter aufhielten, z. B. Aachen, Goslar oder Magdeburg. Der Schutz und die
besondere Förderung dieser Pfalzen durch die Herrscher schufen günstige
Voraussetzungen für die Entwicklung bedeutender Städte. Es gibt jedoch keine
Quellenbelege oder Bodenbefunde dafür, dass der Königshof in
Calbe den Schritt zur Pfalz schaffte.
Die Verwaltung eines solchen
Königshofes wurde von einem "maior" (Meier) bzw. Grafen für die Zeit, in der
sich der König oder Kaiser nicht in der Pfalz bzw. im Königshof aufhielt,
wahrgenommen. Dieser Meier hatte die Aufgabe, die Abgaben der hörigen Bauern
einzutreiben und die Fronarbeit auf dem Königsgut zu organisieren. Bei
Kriegszügen dienten die Königshöfe zur Bergung des eigenen Heeres, also als
"Her-berge". Deshalb waren sie auch stark mit Gräben und Palisaden befestigt und
ständig mit Verpflegung für eine militärische Einheit für zwei Tage ausgerüstet.
Ein solcher Königshof war für damalige Verhältnisse recht groß, etwa ein Achtel
bis ein Viertel Quadratkilometer im Rechteck. Darin befanden sich das
"Herren"-Haus, das Back-, und das Brauhaus, die Scheunen und Ställe sowie der
Brunnen.
|
Über die Frage, welche die Taufkirche des karolingischen oder
ottonischen Königshofes war, gehen die Meinungen auseinander. Die einen Forscher
favorisieren die Hauptkirche der Stadt, die St.-Stephani-Kirche, die anderen
denken an eine nicht mehr existierende, jedoch noch im 18. Jahrhundert
nachweisbare kleine Kirche, die St.-Johannis-Baptistae-Kirche. Die Indizien K.
Herrfurths für eine Kirche Johannes des Täufers scheinen mir durchaus
einleuchtend zu sein. Er führt in einem Beitrag in "Burgen und Schlösser in
Sachsen-Anhalt" (vgl. Herrfurth, Königshof und
Kaufmannssiedlung..., a. a. O., S. 7 ff.) folgende
Fakten an:
1.
1986 wurde Ecke Ritterstraße (damals Straße der Opfer des Faschismus)/Kuhgasse
ein baufälliges Wohngebäude abgetragen. Dabei barg man einen Hausstein des Magisters
Georg Bölau (Belau) von 1667. Nach Aussage Beteiligter wurde auch eine sehr
alte Gebäudemauer mit einer Art Kirchenfenster gefunden, die jedoch undokumentiert beseitigt
wurde. Eine
Einwohnerliste von 1682 führt als Nachbarn des Magisters Bölau einen "Hans
in der Capelle" auf. Auf einem Stadtplan der
Hävecker-Chronik von 1720 ist diese Kapelle noch
eingezeichnet. Ein Vergleich der Calber Abgaben- bzw. Steuerlisten des Mittelalters und der
frühen Neuzeit führt zu dem Schluss, dass es sich bei dieser Kapelle um eine
Kirche Johannes' des Täufers handelte. Diese aber wird öfters mit einem großen
Hof in Verbindung gebracht. So ist u. a. im Stadtbuch Calbe (Landesarchiv
Magdeburg Cop. 406b) für das Jahr 1510 die Rede von der "Kirche und Kapelle
Sancti Johannis Baptistae in unserer Stadt gelegen am großen hoffe". 1777
wurde dieser "Hof mit der ehemaligen Johanniskapelle" noch der abgabefreie "Erbzinshof
des Vizedominats zu Magdeburg" genannt (vgl. Reccius,
S. 80).
2. Das bezeichnete
Gebiet liegt am südlichen Rand und am höchsten Punkt des ältesten Stadtgebietes.
3. Das Patrozinium
Johannes´ des Täufers macht eine frühe Kirchenentstehung wahrscheinlich, da es
sowohl für die karolingische als auch für die ottonische Zeit geradezu typisch
ist.
|
Schon zur Zeit der Karolinger waren
entlang der Elbe-Saale-Linie verstärkt solche Königshöfe und Pfalzen angelegt worden, so dass
angenommen werden kann, dass dieser Königshof in caluo (=calvo) schon seit dem
9. Jahrhundert existierte. Erfahrungsgemäß bildeten sich in der Nähe solcher
Königshöfe sehr bald Siedlungen heraus, aus denen Städte wurden. So konnten z.
B. die Heerstraßen der fränkischen Krieger auch als Handelsstraßen genutzt
werden. Zum Königshof kam wahrscheinlich eine Burg, 300 Meter weiter südlich
gelegen, hinzu, so dass sich die Siedler, meist Handwerker und Händler, relativ
sicher fühlen konnten.
Diese so genannte
Sudenburg (vgl. Station 21) muss aber durchaus nicht eine stolze Burganlage in unserem heutigen
Wortsinne gewesen sein, es könnte sich auch um einen befestigten, geschützten
Platz für die Stadtbewohner gehandelt haben, zumal bis jetzt noch keine
als solche identifizierten Reste
eines Burggebäudes gefunden wurden ("Burg" kommt von "bergen", "verbergen".)
Den frühen Siedlern mag nicht
nur die politisch und wirtschaftlich günstige Position, sondern auch die
"liebliche Auenlandschaft" gefallen haben. Selbst noch zu Beginn des 18.
Jahrhunderts schwärmte der Chronist Hävecker: "Es lässet sich allhier bequemlich
genug wohnen, weil der Circul [Horizont] nicht mit allzu groben Dünsten, wie
sonst vieler Orten geschieht, verdunkelt, sondern mit einer gesunden angenehmen
Luft temperieret wird. So ist auch hier kein ungesundes und Unfruchtbarkeit
verursachendes Wasser... Denn auf der Seite gegen Mittag, Abend und Mitternacht
sind die tragbaren Felder zur Saat für die Menschen und die grünen Auen und
Anger zur Weide für das Viehe..." (Hävecker, a. a. O.,
S. 3) [Zur fruchtbaren Magdeburger Börde s. a.
Station 15.]
Caluo gehörte in frühfeudaler Zeit zum sächsischen
Nordthüringgau. Die Sprachgrenze zwischen Platt- und Hochdeutsch verlief damals
noch bedeutend südlicher als heute. Die höhere Amtssprache war nur noch selten das
Neulateinische, das Volk und die niederen Beamten sprachen und schrieben bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts ein reines Niederdeutsch, wie die Quellen belegen.
Der Umbruch vom Nieder- zum Hochdeutschen zeigte sich in einer
Erbteilungsurkunde von 1489, die schon mehrheitlich hochdeutsche Lautbilder
aufwies (vgl. Reccius, S. 30).
Ein Vergleich zwischen der Willkür (selbst gegebene Stadtordnung - s. Station
2) von 1450 und 1525 führt deutlich den
Sprachumbruch vor Augen.
Ein Artikel lautete 1450:
"Vortmer vorbeiden
de Herren, dat
neymant dorschen laten
bii Lechte, yd sii in Huse
edder in Hove, by
eyner Mark."
1525 lautete der gleiche Artikel:
"Es sal auch nimants bey
Lichte dreschen lassen,
in Scheunen, Hauße
odder Hoffe, bey
eynner Margk."
(Reccius, S. 34)
In der letzteren Version wird bereits die hochdeutsche Lautung sichtbar.
|
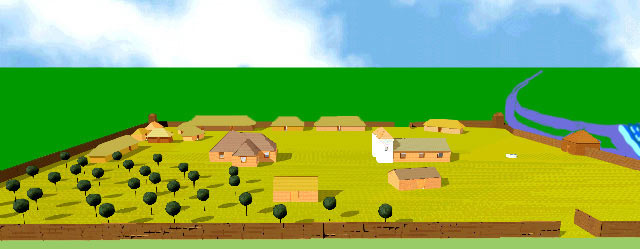 |
|
So könnte der Königshof calvo mit
Herrenhaus (Mitte links), Stephani-Basilika (Mitte rechts) und Mühle
(rechts), wenn man nach Norden schaute, ausgesehen haben, wenn man von
der Meinung ausgeht, die St.-Stephani-Kirche hätte im Zentrum
des Königshofes gestanden. (Computer-Simulation) |
Da der Königshof
etwa seit
dem 9.Jahrhundert existierte, wird auch die erste Siedlung caluo schon
zwischen 800 und 850 zu finden gewesen sein. Die nahe dabei stehende St.-Stephani-Kirche, die
wahrscheinlich die Hauptkirche der Burgwardsiedlung darstellte, wurde ohne Zweifel durch den Halberstädter Bischof Hildegrim(m), der
827 starb, gestiftet.
|
 |
|
Ansicht von
Osten - im Vordergrund die Mühle - Brunnen (dahinter) , Vorratshäuser
und Befestigungsanlagen waren überlebensnotwendig. Für diese Lageversion
spricht allerdings, dass die so wichtige Mühle Bestandteil des
Königshofes gewesen wäre. |
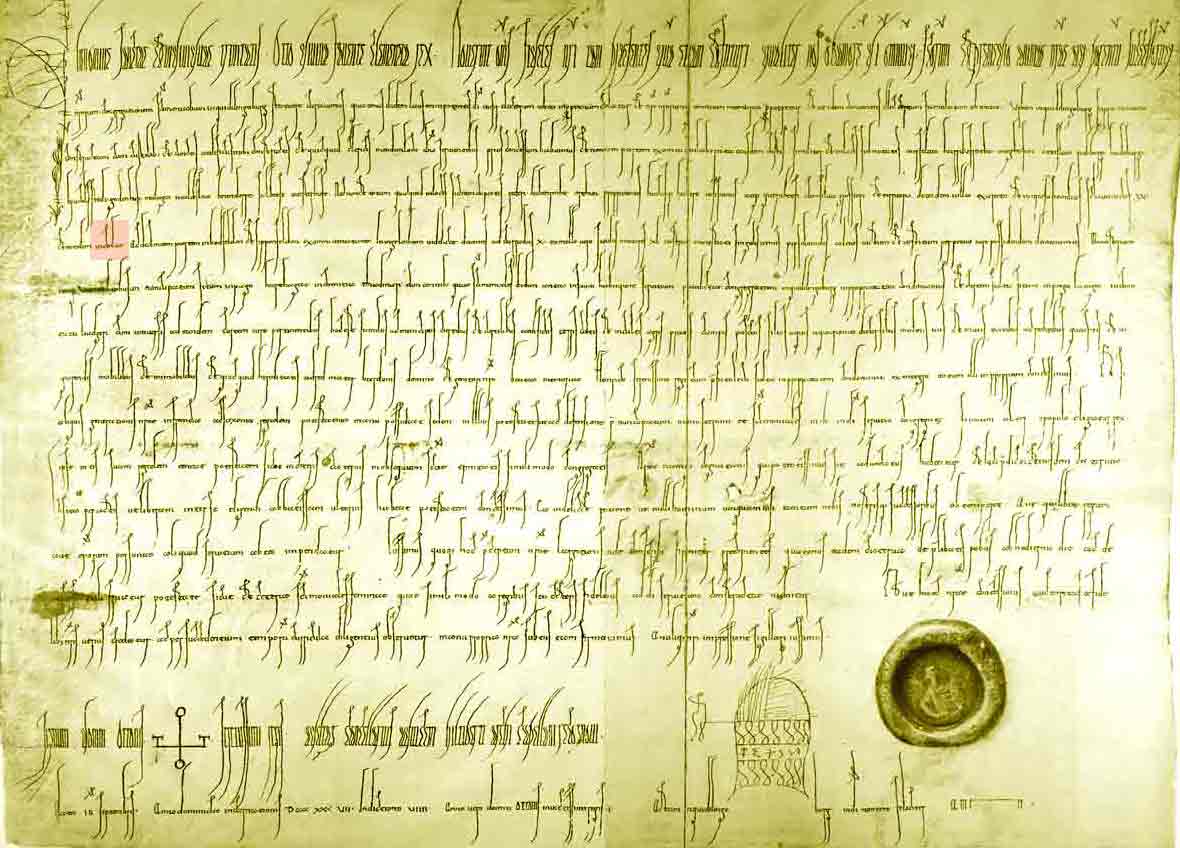 |
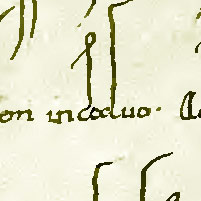 |
|
Die Urkunde vom 13. September 936 |
Ausschnittvergrößerung mit den karolingischen Minuskeln "in caluo" (s.
rosa Markierung linkes Bild) |
Urkundlich erwähnt wurde caluo (lat. calvus =
kahl, mittelhochdeutsch kalwe = kahl) erstmals am 13. September 936, als Otto I.
das Servatii-Nonnen-Stift in Quedlinburg, in dem seine Tochter Mathilde
Äbtissin wurde und wo sein Vater Heinrich I. begraben lag, mit Grund und Boden
u. a. in Mühlingen und 15
slawisch-wendischen Familien in Calbe und Frohse belehnte.
Der Inhalt der in
Kanzleilatein und karolingischer Minuskelschrift verfassten und geschriebenen
Urkunde ist folgender:
Otto I. gründet zu seinem und seiner Eltern und Nachfolger Seelenheil das
Kloster zu Quedlinburg [gemeint ist das St.-Servatius-Nonnenkloster], bestimmt
zu dessen Ausstattung die Burg auf dem Berge daselbst mit ihren Baulichkeiten
und den dortigen Klerikern bisher gemachten Schenkungen, den neunten vom
Erträgnis des Hofes daselbst sowie von Marsleben [nördlich von Quedlinburg,
später Wüstung], Harkerode [?, eventuell Harzgerode] und von 11 anderen Orten,
darunter Mühlingen [mulingo], Westerhüsen [uuesterhuse- heute Stadtteil von
Magdeburg] und Beyendorf [südlich von Magdeburg], seinen Besitz zu Rieder, Hebenrothe [unbekannt], Orda und Quarnbeck (später
Wüstungen östlich und südlich von Quedlinburg), 15 Familien höriger Wenden
[Slawen] zu
Frohse [heute Ortsteil von Schönebeck/Elbe] und
Calbe,
den Jagdzehnt zu Bothfeld und Siptenfelde, Wein- und Honiggeld zu Ingelheim, das
Kloster Wendhausen im Harzgau in der Grafschaft Thiadmars mit dessen ganzem
Besitz, den durch Erbschaft von Adred, der Mutter Bardos, an König Heinrich
übergegangenen Hof Soltau im Leinegau in der Grafschaft Liudgers mit allem
zugehörigen Besitz, stellt dasselbe unter den Schutz und die Gewalt des
jeweiligen Königs, behält aber, wenn nicht mehr jemand seines Geschlechtes in
Franken und Sachsen den Königssitz innehabe, sondern ein anderer vom Volk zum
König erwählt werde, die Vogtei dem jeweiligen Familienoberhaupt seines
Geschlechtes vor, gewährt den Nonnen freies Wahlrecht und Befreiung von den
Leistungen an Könige oder Bischöfe und sichert ihnen alle herkömmlich Rechte,
die ähnlichen Klöstern verliehen worden sind.
|
 |
|
Nach den Indizien von K. Herrfurth
(s. Text oben)
hätten bei einer Sicht von Norden zwei Kirchen das Bild dominiert: die
Kirche oder Kapelle Johannes´ des Täufers innerhalb des Königshofes
und die etwa 220 Meter weiter nördlich gelegene Stephanskirche als
Hauptkirche des Burgwardbezirkes. |
Schon kurz nach seiner Kaiserkrönung gab Otto I. 965 den Königshof
(curtis regia) in Calbe auf
und belehnte das Mauritius-Kloster in Magdeburg, das Kloster seiner
Lieblingspfalz, damit.
Da in späteren Jahren von einem adligen Freihof an ungefähr der gleichen Stelle
die Rede ist, ist anzunehmen, dass zunächst einmal Ministerialen (Dienstmannen)
auf dem Gut eingesetzt wurden, die dem Erzbistum verpflichtet waren.
Ministerialen waren
in karolingischer und salischer Zeit Unfreie, also
Hörige und Leibeigene,
die während der Konsolidierung des Feudalismus eine bedeutsame Stütze der Krone
und des Hochadels als Hofangestellte, Staatsbeamte oder Krieger wurden. Da sie
anfangs noch keine Vasallen wie die adligen Ritter, die Berufskrieger des Mittelalters,
waren, besaßen sie auch noch keine erblichen Güter. Das bedeutete eine festere
Bindung an ihre Herren. Besonders die Kirchenfürsten setzten beim Landesausbau
im 11. und 12. Jahrhundert gern und verstärkt unfreie Dienstmannen ein. Auf dem
ehemaligen Königsgut calvo und nachmaligen Kirchengut des Erzstifts Magdeburg
haben demnach anfänglich durchaus "dinestliute" des Erzbischofs ihren
Verwaltungs- und Kriegsdienst getan. Langjährige Forschungen über die
Ministerialität des Erzstifts Bremen geben uns, wenn wir analoge Schlüsse ziehen,
interessante Hinweise für das Erzstift Magdeburg.
Das Werk "Ritter und
Knappen zwischen Weser und Elbe" von Hans G. Trüper zeigt, dass der Aufstieg der
Ministerialen, übrigens im gesamten Heiligen Römischen Reich nur im deutschen
Bereich geschehen, einer der faszinierendsten Vorgänge des deutschen
Mittelalters war: Aus diesen meist unfreien Dienstmannen, die bewaffnet und
beritten für Könige, Herzöge und andere Herren stritten, wurden kampfkräftige,
selbstbewusste Ritter und Knappen, oftmals schließlich einflussreiche
Landadelige mit Grundbesitz.
Im Erzstift Bremen entstand die Ministerialität im 11. Jahrhundert, zur Zeit von
Erzbischof Adalbert (1043-1072), und schon bald waren Ministerialen die
wichtigsten Herrschaftsträger des Erzbischofs: Sie stellten nicht nur das Gros
des mittelalterlichen stiftsbremischen Ritterheeres und die Mannschaften der
erzbischöflichen Burgen, sie hatten auch die Hofämter (Mundschenk, Truchsess,
Kämmerer und Marschall) des Erzbischofs inne. Als Meier (villici) verwalteten
sie die erzbischöflichen Haupthöfe, als stadtsässige Ministerialen (burgenses)
die erzbischöfliche Residenz. Ministerialen waren als Vögte die wichtigsten
Verwalter des Erzstifts. Sie besetzten die Positionen der Zöllner, Münzer und
Wechsler und stellten in den Städten den überwiegenden Teil der frühesten
Ratsfamilien (vgl. Trüper, a. a. O.).
Wie war es zu diesem
frappierenden Aufstieg gekommen?
Die unfreien
Dienstmänner bildeten nicht nur die verlässliche Kerntruppe und Masse der
fürstlichen Streitmacht, sie waren auch die loyalen Hofleute und vertraten als
Beamte den Rechtsstandpunkt ihres Herren im Lande. Allmählich strebten auch
immer mehr Freie und verarmte adlige Vasallen (Ritter) nach solchen zwar
unfreien, aber sicheren und einträglichen "Posten". Während des
Investiturstreites (1075-1122) konnten die Ministerialen entscheidend ihre
Position festigen. Sie brachten ihre Herren objektiv in Abhängigkeit von ihnen,
denn ihr Einfluss war häufig das einzige sichere und kontinuierliche Element
fürstlicher, besonders aber kaiserlicher Herrschaft. Auch konnte ihre Stellung
dank der geleisteten Dienste nicht mehr rückgängig gemacht werden. Oftmals
entwickelten diese Unfreien mehr Standesbewusstsein als die alteingesessenen
edlen Ritter. "Die Grenzen zwischen freien Rittern und den Ministerialen
verschwammen allmählich; die Dienstgüter der Ministerialen, auf deren Grundlage
sie ihren Lebensunterhalt bestritten, wandelten sich von nicht vererbbaren
Dienstlehen in erbliche Lehen" (Microsoft® Encarta® Professional 2002). Ab dem
13. Jahrhundert zählten die Ministerialen zum niederen Adel, sie waren auch
adlige Ritter geworden.
Aus dieser Schicht stammten auch
die seit dem 12. Jahrhundert in den Ratsakten - meist als Zeugen - auftauchenden Adligen, die
mit dem "adlichen großen Hoffe" in Verbindung gebracht werden: Dienstmann
Dietrich von Calbe (1105), Dienstmann Dietrich von Hachen (1162) (erster Hinweis
auf einen Ministerialen "von Haken), Dienstmann Hugold von Calbe (1185),
Dienstmann Alexander von Calbe (1202), Richard von Calve (1242), Ritter Johannes
von Calbe (1263), Ritter Konrad und Rodestus von Calve (Vater und Sohn) (1271).
Zwei dieser genannten Dienstleute hatten es sogar bis zum "villicus" bzw.
"Vogt", d. h. Gutsverwalter gebracht: Dietrich (1105) und Johannes (1263) (vgl. Reccius,
Chronik..., a. a. O., S. 6 ff.).
Übrigens weist auch der erste Name der jetzigen Ritterstraße auf die Leute hin,
die dort vor tausend Jahren ihren Dienst versahen: "Herrenstraße" oder
"Herrengasse". Als "Herren" bezeichnete man im Mittelalter die Angehörigen der
untersten Stufe der feudalen Herrschaftsstruktur. Danach folgten aufwärts die
adligen Ritter, die Grafen usw. Obwohl ein Dienstmann selbst juristisch unfrei
war, war er doch "Herr" über die ihm untergebenen Hörigen und
Leibeigenen und wurde als solcher angeredet.
(Zu Beginn des
14. Jahrhunderts war es dann für einen befestigten Hof der Erzbischöfe innerhalb
der rasch anwachsenden Stadt zu eng geworden, und unter Burchard (Burghard) III.
begann man 1314 mit dem Bau einer Veste am nordöstlichen Rand der Stadt. Dort
saßen nun die erzbischöflichen Vögte, und von dort aus wurde ein Teil der
landesherrlichen Regierungsgeschäfte getätigt. Vgl.
Station 11)
15.
Jahrhundert:
Ein Zweig der von Hackes aus
dem Merseburgischen bekommt das Burggut (Rittergut) Calbe zum Lehen. Es heißt
dazu bei Mülverstedt im "Neuen Siebmacher":
"Im Stiftsgebiet von Merseburg sind zwei altritterliche Geschlechter dieses
Namens zu unterscheiden, von denen die Adelslexicographie nichts Bestimmtes oder
Sicheres anführt, sondern vielmehr sie und ihre Güter mit andern Familien
gleichen Namens untermischt. Das grössere und angesehenere schon seit Anfang des
14. Jahrh. urkundlich nachweisbare hatte namentlich zu Oberthau, Kitzen und Kl.
Dölzig Jahrhunderte lang Grundbesitz und zweigte sich im 15. Jahrh. auch nach
Calbe a/S. auf einem dortigen Burggut im Erzstift Magdeburg ab."
(Aus: HACKE VI, merseburgisch, in:
Ausgestorbener Preussischer Adel, Provinz Sachsen (exl. der Altmark) / bearb.
von G. A. v. Mülverstedt, in: J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappenbuch
; 6,6, Nürnberg 1884.
1451 schreibt die Willkür (selbst gegebene Stadtordnung - s. Station
2) vor, dass keiner einen eigenen Viehhirten besitzen
durfte (vgl. Reccius, S. 27). Dieser Artikel in der
Willkür ist wiederholter Streitpunkt mit den Rittergutsbesitzern bis in die
Neuzeit gewesen. Hävecker konstatiert dazu: "Keiner von Adel oder welcher solche
Güter gepachtet hat, ist befugt gewesen, einen eigenen Hirten zu halten, sondern
muß sein Viehe unter die allgemeine Hut treiben." (Hävecker,
S. 29)
1459 ist das Schloss Calbe noch zu klein, dass sich verschiedene wichtige
Verwaltungsämter laut einem Nachlassverzeichnis noch außerhalb desselben
befinden. Reccius vermutet die Vogtei im Rittergut (vgl.
Reccius, Seite 28).
1500 bestraft !!! der Konvent der 12 Bauermeister Simon
Hake mit der Zahlung von 100 Gulden !!!, weil "er in seiner Gewalt
excedierte" [über seine Machtbefugnisse hinausging - D. H. St.] (vgl.
Hävecker, S. 21). Der Konflikt zwischen den adligen
Grundbesitzern und den stadtbürgerlichen Kräften tobte schon seit langer Zeit
(vgl. Station 2 - wird
demnächst in diese Station eingearbeitet).
1511 belehnt Erzbischof Ernst (vgl. Seite
4 und 5) den
ritterbürtigen Amtmann Simon Ha(c)ke (1498 -1520) mit dem Freihof
innerhalb der Stadt (vgl. Reccius, S. 32.).
1541 haben die von
Ha(c)kes am rechten Torpfeiler der Einfahrt zum Freihof, Ritterstraße 1, ihren
Namen und ihr Familienwappen anbringen lassen, das noch bis Anfang des 20.
Jahrhunderts dort zu sehen war. Auf einer kleinen Steinplatte konnte man die
Inschrift "Otto und Jacob, die Peusten genannt. Haken" lesen. Ein
Wappenschild darunter zeigte das Wappen der Familie von Hacke: einen Helm
mit Helmdeckel und Zier mit der Zahl 1541 an der Spitze sowie einen Schild.
Dieser trug einen Schrägstrich mit drei glockenartigen Figuren. Auch dieser
Wappenstein befand sich am rechten Torpfeiler (nach: Unterlagen des Institutes
für Denkmalpflege, Halle). Bei der Umgestaltung der
St.-Stephani-Kirche im Jahr 1866 kam auch der Grabstein eines weiteren Simon
Hacke ans Licht, eines 1581 bis 1584 regierenden Schlosshaupt- und Amtmannes.
Die Grabsteine sind heute nicht mehr sichtbar (vgl.
Station 5); deshalb ist die Veröffentlichung
der Inschriften durch Max Dietrich verdienstvoll. Der Text lautete: "Anno dm.
[Zahl unleserlich] an de tage Johannis Baptistae ist in Gott verstorben der
gestrenge und veste Simon Hacke, hat ob den 3 : jar altz ey getrewer amptman hyr
tzu Calbe geregirt. Dem Got gnade." (Dietrich, Calbenser
Ruhestätten, S. 5)
1568
verleiht ein Lehnbrief für Jacob und Caspar Hacke den Freihof zu Calbe mit immer
wieder in den Dokumenten auftauchenden 3 Hufen
Landes, den Freihof Zuchau sowie die damit verbundenen Abgaben der
erbuntertänigen Bauern und Häusler (vgl. Reccius, S.
33). Diese 3 Hufen (ursprünglich Königshufen)
sind ein Indiz für den ministerialen Ursprung des Gutes (vgl. Kleine
Enzyklopädie - Deutsche Geschichte, Leipzig 1965, S. 719). Typisch für die Zeit
der feudalen Wirtschaft ist, dass durch ständig wechselnde Besitzverhältnisse
aufgrund von Erbschaften, Heiraten und auch Eroberungen ein verwirrender
Flickenteppich der verschiedensten Besitztümer entstanden war, wie er sich uns
auch in solchen Lehnbriefen zeigt. Dieser Zustand war wiederum eine Ursache für
immer erneute Gewalt und Kriege. Erst in der späteren Neuzeit, als sich
der Begriff Rittergut in Preußen durchgesetzt hatte, legte man aus
ökonomisch-technischen Gründen mehr Wert auf größere zusammenhängende Flächen,
was wiederum mit dem tragischen Vorgang des "Bauernlegens" verbunden war. (Wer
sich genauer mit dem ständig wechselnden "Flickenteppich" beschäftigen möchte,
dem wird die Reccius-Chronik empfohlen.)
1592 Dem Junker von
Hacke wird von Seiten der "Sechsmänner" (vgl. Station 2)
vorgeworfen, entgegen der "Willkür" (Stadtordnung) eigene Hirten zu halten (vgl.
Reccius, S. 41).
1595 verkaufen die von
Ha(c)kes, die etwa zweihundert Jahre im Besitz des Rittergutes Calbe waren,
dieses an das Herren-Geschlecht derer von Ingersleben (vgl. Reccius,
S. 44).
1601 Hävecker schreibt über den Verkauf des adligen Freihofes für 9000
Taler an Carl von Ingersleben (vgl. Hävecker,
S. 80). In der Leichenpredigt für Magdalena von Ingersleben heißt ihr Vater
aber: Hans von Ingersleben. Da dem 80jährigen Chronisten Hävecker nachweislich
ab und zu Ungenauigkeitsfehler unterliefen und möglicherweise auch der Lapsus
bei einem Schreiber der Ratsakten zu suchen sein könnte, ist dem Wortlaut der
gedruckten Leichenpredigt eher zu trauen. Die Angehörigen werden sicherlich
Unwahrheiten nicht geduldet haben. Danach wäre seit 1601 Hans von Ingersleben
der Besitzer des Rittergutes Calbe gewesen. Bald danach muss er gestorben sein.
1604 heiratet der wahrscheinlich jüngere Joachim Balthasar von Haugwitz
die 41jährige Ingersleben-Tochter, Magdalena, und hat mit ihr einen Sohn,
Christian
Friedrich.
Magdalena stirbt 1611.
1614 erneute Heirat des Witwers Joachim Balthasar von Haugwitz mit der jungen Sophie von Veltheim, der
Tochter des Schlosshauptmannes Günzel von Veltheim.
(Das Jahr der
Hochzeit erfahren wir aus einer Aktennotiz:
1614 ersucht der Schlosshauptmann Günzel (Guntzell) von Veltheim den Rat, zu
gestatten, dass der neue Wirt vorm Schlosstor anlässlich seiner Tochter Hochzeit
Zerbster Bier ausschenken darf. Der Rat lehnte das zunächst mit allerlei
Begründungen ab, gab aber schließlich doch unter Maßgabe einer einmaligen
Ausnahme seine Zustimmung. Offensichtlich wollte man es sich nicht mit zwei
schwierigen Adelsgeschlechtern - der Bräutigam war der Rittergutsbesitzer
Balthasar von Haugwitz - verderben. Mit dem Schlosshauptmann Günzel
von Veltheim hatte es 1599 ein schweres Zerwürfnis gegeben, als Bürgermeister
Wilke und Ratsschenk Brune hinterhältig auf Hoheitsgebiet des Schlosses gelockt
und anschließend ins Gefängnis geworfen worden waren (vgl.
Reccius, S. 42).)
Die Familie von Veltheim stammt vom Rittergut Harbke.
1622 wird Joachim
Balthasar und Sophie eine Tochter von großer Schönheit, Anna Margareta, geboren.
1624 hat Joachim Balthasar von Haugwitz Streit mit dem Rat der Stadt,
weil er sein Vieh nicht zusammen mit dem Vieh der Bürgerschaft von städtischen
Viehhirten hüten lassen will, wie es bisher immer üblich war. Eigene Hirten zu halten, begründet von Haugwitz damit, dass der Stadthirte
schon Rittergutvieh umkommen lassen oder verletzt zurück geführt habe. Wenn
dieser Missstand abgeschafft werde, wollte er sein Vieh auch wieder mit dem der
Bürgerschaft austreiben lassen (vgl. Reccius, S. 48).
1626 Joachim Balthasar von Haugwitz stirbt „frühzeitig“ in Brandenburg
und kann, durch die Kriegswirren bedingt, nicht in Calbe beerdigt werden (vgl.
Leichenpredigt auf seinen Sohn Christian Friedrich. Wenn in der
Leichenpredigt das Wort „frühzeitig“ gebraucht wird, dann nicht so, wie wir das
heute manchmal meinen, nämlich aus der Sicht der liebenden Hinterbliebenen.
Damals hieß „früh“ ohne Vorankündigung und ohne kirchlichen Beistand. Es könnte
also der Tod durch eine Seuche oder durch Kriegsgewalt gemeint sein.)
Nach Anna Margaretas Selbstbiographie war sie beim Tod des Vaters 4 Jahre alt,
was uns auf das Jahr 1626 verweist.
1630 Bei dem
verheerenden Massaker der Kaiserlichen am 22./23. September in Calbe sterben
auch noch die Mutter und vier Geschwister. Barmherzige Menschen bringen
die achtjährige Waise Anna Margareta nach Egeln (ca. 25km von Calbe entfernt) in
ein Zisterzienserinnen-Kloster. Anna Margaretas etwa 25jähriger Halbbruder
Christian Friedrich ist zu jener Zeit sicherlich als Offizier unterwegs.
Als er 1656 stirbt, ist er im Range eines Hauptmanns. Auf alle Fälle
übernimmt Christian Friedrich, vielleicht aber erst nach Kriegsende, das
verwilderte Rittergut. (Anna Margareta heiratet 1640 im Feldlager
bei Saalfeld den schwedischen Generalmajor und späteren Reichsmarschall Carl Gustav Wrangel und wird mit ihm
allem Anschein nach glücklich.)
Christian Friedrich von Haugwitz, nunmehr Besitzer des Rittergutes, heiratet
eine adlige Dame von Werdensleben (vgl. Hävecker,
S. 80). Ihre zwei Kinder, die nach der schönen Tante Anna Margarethe bzw. nach
dem berühmten Onkel Karl Gustav genannt worden waren, sterben schon im Alter von
2 Jahren bzw. 9 Monaten, wie Gruftinschriften unter dem Chorraum der St.-Stephani-Kirche belegen (vgl.
Rocke, a. a. O., S.97).
1656 stirbt Christian Friedrich von Haugwitz ohne Erben. Hävecker
schreibt, dass mit Christian Friedrich „… die von Haugwitze, …, so viel derer im
Ertz-Stifft Magdeburg gewesen sind, … gantz ausgestorben“ seien. (Er meint
natürlich nur die männlichen Erben, bezogen auf das Magdeburger Land.)
1665 „…hat dasselbige Gut Matthias von Schlegel, Schwedischer Major,
theils durch Heyrath mit der Wohlgebohrnen Hauchwitzischen Wittben … theils
durch Kauff an sich gebracht …“. (Da durch die Bestimmungen des Westfälischen
Friedens große Teile Norddeutschlands unter schwedischer Herrschaft standen,
waren viele deutsche Adlige gezwungen, in die Dienste der Besatzungsmacht zu
treten. Deshalb war wohl von Schlegel schwedischer Major geworden. Die
Vormachtstellung Schwedens im norddeutschen Raum ging erst zu Ende, als
ausgerechnet ein Schwager Schlegels, nämlich der Witwer Anna Margaretas, Karl
Gustav Wrangel Graf von Solms
[auch: Salmis], am 25.6.1675 die wirklich historische Schlacht bei Fehrbellin
verlor und damit der Weg zum Aufstieg der neuen Großmacht Preußen geebnet war.)
1684 stirbt das Ehepaar von Schlegel kinderlos (vgl.
Hävecker, ebenda). Das Rittergut fällt an die
kurbrandenburgische Krone, die erst vor 3 Jahren das ehemalige Erzstift
Magdeburg nach den Bestimmungen des Westfälischen Friedens zugesprochen bekommen
hatte.
1685 erwirbt der
Syndicus Johann Friedrich Reichenbach das Rittergut vom kurbrandenburgischen
Staat "erbkauffsweise samt allen Pertinentien [Zugehörigkeiten -
D.H.St.] und zugehörigen Gerechtigkeiten, Aeckern, Wiesen und Garten" (Hävecker,
ebenda). Demnach besaß der in den Adelsstand erhobene (vgl. FamilySearch) von
Reichenbach sowohl das beachtliche Rittergut als auch den stolzen Lemmerhof.
Er hatte 1666 in Leipzig studiert, wurde am 29.4.1675 in Calbe als Syndicus
vereidigt und hier 1708 von der königlich-preußischen Regierung als
Bürgermeister eingesetzt. 1710 stirbt Johann Friedrich Reichenbach
(Recherchen von K. Herrfurth).
1694 wird das
Rittergutshaus der Reichenbachs in der Ritterstraße 1 durch eine Feuersbrunst
vernichtet
1715 lässt die Witwe des Johann Friedrich Reichenbach, Anna Katharina,
geborene Fiedler, das Rittergutshaus neu aufbauen. Anlässlich der Fertigstellung
und Einweihung des neuen Hauses wird zur Erinnerung am linken Torpfeiler der
Einfahrt zum Rittergutshof eine in lateinischer Schrift abgefasste Inschrift mit
17 Zeilen angebracht. Der Text lautet übersetzt:
|
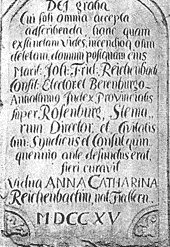
|
|
Fotografie der Inschrift von 1715 (nach:
Archiv des Institutes für Denkmalpflege Halle) |
"Mit Gottes gnädiger
Güte, dem allein alles, was man empfängt, zuzuschreiben ist, hat dieses Haus,
das du hier errichtet siehst, und das ehedem durch eine Feuersbrunst vernichtet
war, die Witwe Anna Katharina Reichenbachin geb. Fiedlern 1715 wieder aufbauen
lassen, nachdem ihr Gemahl Johann Friedrich Reichenbach, kurfürstlicher
(brandenburgischer) und bernburgisch - anhaltinischer Rat, Landrichter über
Rosenburg, Steuerdirektor und von hiesiger Stadt Syndicus und Bürgermeister,
fünf Jahre vorher verschieden war."
1717
verzichtet der preußische König im Lehnsallodifikationsedikt in größerem
Umfang auf sein Obereigentum an den ursprünglich zu Lehen gegebenen
Rittergütern. Damit waren die ehemaligen Freigüter der Ministerialen zu
Volleigentum des Adels geworden.
1721 heißt die bisher
"Herrenstraße" genannte Straße am Rittergut "Ritterstraße" (vgl.
Reccius, S. 69).
1752 wird der
bürgerliche Andreas Fran(c)ke, wohnhaft in der Poststraße, Pächter des von
Reichenbachschen Rittergutes (vgl. Reccius, S. 76)
Nach dem
Lehnsallodifikationsedikt von 1717, das die adligen Herren zu alleinigen
Besitzern der Rittergüter machte, hatte ein Teil von ihnen begonnen, sie auch an
bürgerliche Interessenten zu verpachten.
Außer den Fran(c)kes ist aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts auch die bürgerliche Familie der Pieschels als Pächter
bekannt. (Der 1886 verstorbene, aus Brumby stammende Pächter Georg Pieschel war
bismarckorientiertes nationalliberales Mitglied des Preußischen
Abgeordnetenhauses gewesen. Das Grabmal der Familie Pieschel, die in Calbe ein
bedeutendes soziales Engagement bewies, befindet sich auf dem Friedhof am
Hauptweg.)
1785 besitzt das
eigenständige Rittergut etwa ein Zehntel des Viehbestandes der Stadt Calbe (44
Rinder, 200 Schafe, 8 Pferde, vgl. Reccius, S. 81 f.
und auch Station 15).
1790 stirbt Johann
Friedrich Aribert von Reichenbach, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr des Rittergutes
in Calbe und wird im Reichenbachschen Erbbegräbnis an der Südseite der
Stephanikirche (eine kleine Sandsteinplakette ist noch vorhanden) beigesetzt
(vgl. Abb. rechts). Er war der letzte der Reichenbachs, die in Calbe wohnten
(vgl. Reccius, S. 82).
 |
|
Reichenbachsches Erbbegräbnis an der
Südseite der Stadtkirche (1912) |
"Über die Situation des Rittergutes zu dieser Zeit kann folgendes gesagt werden:
Das steinerne Wohnhaus mit zwei Stockwerken war 1715 gebaut worden. Es ist so
eingerichtet gewesen, dass oben der Rittergutsbesitzer wohnte und unten der
Pächter oder Wirtschaftsverwalter. Der gesamte Komplex an der Ritterstraße hatte
alle für die Land- und Hauswirtschaft notwendigen Gebäude: Scheunen, Viehställe,
Brauhaus, Wechselhaus, Gerätehaus, Taubenschlag usw. Nach 1790 wohnte oben nur
noch die Witwe des letzten Reichenbach."
(Schwachenwalde, Hanns, Das Rittergut
Calbe, ms. Manuskript)
1797 gehört zum
Rittergut "ein ehemaliger Weinberg, welcher in Acker verwandelt ist, 7,5 Morgen
enthält und in der Bernburger Vorstadt etwa über dem Gottesacker an der
Lorenzkirche zwischen Häusern eingeschlossen liegt. Deshalb auf der anderen
Seite der Bernburger Straße zwischen dem Gasthof <Zum goldenen Engel> und
anderen Häusern eingeschlossen ist ein großer Garten von sieben Morgen oder 1400
Quadratruten mit 1200 bis 1400 tragbaren Obstbäumen besetzt (Rute etwa 3,8 m).
An Wiesen gehören dazu 18 Morgen in drei Stücken unter den Rosenburgischen
Wiesen, die aber nur einschürig sind [d. h. nur einmal im Jahr gemäht werden
können - D.H.S.]. Zwei eigentümliche Häuser, ein größeres und ein kleineres
(worin 16 Wohnungen oder Stuben) am Weinbergsacker gehören auch dazu.
Ingleichen 15 Kolonisten- oder Grundzinshäusern an etwa diesem Acker, wovon
jedes vier Taler an das Rittergut jährlich entrichtet, auch einen Menschen vier
Tage zu eigener Kost in der Ernte zum Herrendienst stellet oder dafür nach der
Willkür der Rittergutsbesitzer ein gewisses Geld bezahlt - zur Zeit je 16
Groschen. Ferner ein eigentümliches Haus mit vier Wohnungen auf der anderen
Seite der Vorstadt am Baumgarten gelegen.
Auch sieben Anbauhäuser eben daselbst am Garten an der Straße [heute Bernburger
Straße 67 bis 70] und hinten am Saaleufer [heute Große Fischerei 36 bis 38].
Grundzinsen werden entrichtet von einigen Häusern in der Stadt selbst, von sechs
Häusern in der Schloßvorstadt [heute kleine Angergasse 5 bis 10] und von
verschiedenen Häusern und Äckern in Staßfurt, Bernburg, Zens und anderswo." (Kinderling,
Eine Ortsbeschreibung ..., a. a. O.)
Zum Rittergut gehörten in der Mitte des 18. Jahrhunderts 345 Morgen Acker, die überall zwischen den Bürgeräckern verstreut, aber
großenteils nahe bei der Stadt lagen. Sie bestanden jeweils aus zwei, vier und
zehn bis 15 Morgen großen Flächen (vgl. Schwachenwalde, ebenda). Seit der Zeit
des ministerialen Freihofes waren schon einige Flächen "zusammengewachsen", aber
zur landwirtschaftlichen Großraumwirtschaft wie im ostelbischen Bereich hatte
das nicht geführt.
1802 überlassen
entfernte Erben des letzten Rittergutsbesitzers, die Gebrüder Reichenbach, dem
Zimmergesellen Gebhart Ehlert 18 Quadratruten (ca. 68 m²) von dem zum Rittergut gehörenden
Weinbergsacker in der Bernburger Vorstadt zur Erbauung eines Kolonistenhauses.
Dafür muss Ehlert, ausgenommen seine Hausbau-Zeit, in einem gewissen Umfang dem
Rittergut zinsen und dienen (Abgaben und Dienste leisten) und ist der
Gerichtsbarkeit des von Reichenbachschen Rittergutes unterworfen.
Noch hatte Napoleon die feudalen Rudimente in Preußen nicht beseitigt.
Rittergutsbesitzer hatten schon seit den Anfängen der adligen Freihöfe außer
anderen Obrigkeitsrechten die niedere Gerichtsbarkeit und die Polizeistrafgewalt
über die untertänigen Bauern inne. Darum gab es
auch an der früheren kleinen Eingangspforte zum Hof des Gutes ein Halseisen wie
am Markt oder am Schlosstor, an das straffällige Hintersassen des Rittergutes
angeschlossen wurden (vgl. Dietrich, Ruhestätten, S.
14). Diese Stelle nannte man den Pranger des Rittergutes.
1811 haben die Reichenbachschen Erben das Rittergut inzwischen an den
Färbermeister Andreas Friedrich Schmidt verkauft, einen Schwiegersohn des
bisherigen Pächters Fran(c)ke (vgl. 1752). Schmidt kann das Rittergut aber wegen zu großer
Schulden nicht halten und verkauft es an den Baron von Stedingk.
1814 verkauft der Baron von Stedingk 281 Morgen des zum Rittergut
gehörenden Landes an verschiedene Käufer. Die gesamte Wirtschaft des Freigutes
wird also um ca. 80 Prozent reduziert. Ein landwirtschaftliches Unternehmen im
19. Jahrhundert, das so stark eingeschränkt wird statt zu expandieren, ist
faktisch dem Untergang geweiht.
Unter der Herrschaft
Napoleons waren die feudalen Ritterguts-Vorrechte aufgehoben und durch die
preußischen Agrarreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Erbuntertänigkeit
und Leibeigenschaft in einem schleppenden Prozess in kapitalistische
Abhängigkeit eines neuen Landproletariats umgewandelt worden. Rittergüter
bekamen als bürgerlich-kapitalistische landwirtschaftliche Großunternehmen ein
völlig neues sozialökonomisches Gesicht.
Diesen Wandlungsprozess machte
das Gut mit dem Zentrum Ritterstraße Nr. 1 aber nicht mit; dafür entstanden
andere landwirtschaftliche Großraumwirtschaften um Calbe, wie z. B. am so
genannten Damaschkeplan das Gut von Otto Bartels mit seinem in
einem überladenen Stilgemisch 1884/85 errichteten "Bartelshof".
1818 gibt Baron von
Stedingk das Rittergut auf und verkauft das Wohnhaus und die Wirtschaftsgebäude
Ritterstraße 1 an den Calber Unternehmer Christian Andreas Schwenke.
Eingeschlossen in diesen Verkauf ist auch das Gelände des ehemaligen Baumgartens
an der späteren Nicolaischen Wolldeckenfabrik ("Engelsgarten" nach dem damaligen
"Gasthof zum Engel"). Den zum ehemaligen Gut gehörenden
Lorenzgarten (zwischen Bernburger Straße und Großem Lorenz) erwirbt 1847 die
spätere Bergwerksunternehmer-Familie Douglas von den Schwenkes.
Der Verkaufspreis beträgt insgesamt 3 250 Taler
(vgl.
Schwachenwalde, ebenda).
Mit diesem Vorgang ist der
adlige Freihof und das Rittergut "binnen der Stadt" nach einer nahezu
tausendjährigen Geschichte endgültig aufgelöst!
Wie ging es weiter ? (u.
a. nach: Acta der Polizei-Verwaltung... Ritterstraße Nr.
1... Sect. II Littr.G Nr. 19, a. a. O.]
|
1832 wird auf dem Grundstück Ritterstraße 1 eine
weitere, größere Posthalterei als in der
Poststraße (heute:
August-Bebel-Straße) durch Ferdinand Schulze eingerichtet. (Posthalter
Schulze ist später aktives Mitglied des von Wilhelm Loewe mit initiierten
"Vereins für Volksrechte".) Die groß angelegten Ställe, das geräumige
Gerätehaus und der weite Hof eigneten sich gut als neue Posthalterei im
Rahmen der im ersten Drittel des 19. Jahrhundert schnell steigenden
postalischen Frequenzen.
1870 verkauft die Witwe des Posthalters Schulze das Grundstück an den
Wagenbau-Unternehmer Hohmann. Der Wagenfabrikant baut in der Ritterstraße
Nr. 1 Kutsch- und Gebrauchswagen. Er wohnt mit seiner Familie im ehemaligen
Rittergutshaus. Außer ihm sind noch die Familien eines Hohmannschen
Angestellten und eines Handwerkers in dem Haus untergebracht.
1923 haben die Hohmannsöhne infolge der Inflation die Wagenproduktion
eingestellt und das Grundstück Ritterstraße 1 an den Unternehmer Grolich
verkauft, der hier eine Rohkonservenfabrik als Filiale seines in Liegnitz
(Niederschlesien) befindlichen Hauptunternehmens einrichtet. Im Hause wohnen
noch zwei leitende Angestellte und ein Arbeiter des Unternehmens. Nach 1930
wohnen im ehemaligen Rittergutshaus zunehmend auch Nicht-Betriebsangehörige
als Mieter.
1939 gibt die Firma Grolich ihre Zweigstelle auf, und die Calbesche
Gemüsekonserven-Firma Albrecht übernimmt den Komplex Ritterstraße 1 mit dem
inzwischen als Miethaus genutzten ehemaligen Gutshaus.
1972 wird die inzwischen "halbstaatliche" Firma Albrecht
mit mehr oder weniger Druck
in "Volkseigentum" überführt. Als Betriebsteil des VEB
"Rohkonserven Calbe/Saale" (ab 1.1.1974 VEB "OGEMA", Obst- und
Gemüseverarbeitung Magdeburg) ist das Gelände Ritterstraße 1 bis 1976 eine
von mehreren Produktionsstätten für Calbesche Gemüsekonserven. In den 1970er
Jahren bleibt das ehemalige Gutshaus teilweise noch bewohnt. Danach beginnen
die Hofgebäude und das historische Haus zu verfallen.
1989 wird der
Rechtsnachfolger des VEB "OGEMA" die Regos-GmbH. (vgl. Schwachenwalde,
ebenda).
Heute wartet das historische
Rittergutshaus auf eine Sanierung. |
|
 |
 |
|
Portal des ehemaligen Rittergutshauses (Design des 19. Jahrhunderts) |
Ornamentik am Portal |
|
 |
|
Das
zentrale Gebäude des Rittergutes Calbe zu Zeiten des Spätbarocks
(Computersimulation mit "ArCon") |
Die oben genannten Ritterfamilien waren in ihrer Zeit nicht unbedeutend.
Das Rittergeschlecht derer von Hacke (Hake) hatte sich vom Mansfelder
und Merseburger Gebiet bis nach Brandenburg ausgebreitet. Hans von Hacke
schrieb man jene bekannte Anekdote zu, Tetzel 1517 einen Blanko-Ablassbrief
für einen künftigen Raub abgekauft zu haben, um ihm dann in den Jüterboger
Wäldern die päpstliche Geldtruhe zu rauben und das mit jenem Freibrief zu
rechtfertigen. Tatsache ist, dass die von Hackes tatkräftige Förderer der
Reformation waren, besonders der Ritter Albrecht von Hacke.
Theodor Fontane hat den Hakes und Hackes ein
literarisches Denkmal im vierten Teil seiner "Wanderungen
durch die Mark Brandenburg" im Kapitel "Kleinmachenow oder Machenow auf
dem Sande" gesetzt. In Calbe wurden die von Hackes (Hakes) im 15.
Jahrhundert ansässig. Simon Ha(c)ke war von 1498 bis 1520 Schlosshauptmann
(vgl. Hertel, Geschichte ...,S. 172), das heißt,
der Stellvertreter (Vogt) des Erzbischofs im hiesigen Amtsbezirk in allen
weltlichen Dingen. In Abwesenheit des Landesherren oblagen ihm jegliche
ökonomischen, politischen, juristischen, sozialen und militärischen
Angelegenheiten. 1584 taucht in der Liste der Schlosshauptleute Adam Ha(c)ke
auf (vgl. ebenda). Die Ha(c)kes trugen in ihrem
Wappen symbolisch einen Haken. Simon Ha(c)ke war der Stifter der
Wrangelkapelle (1495) an der
St.-Stephani-Kirche nahe dem Rittergutsgebäude. An ihr ist das
Hackenzeichen noch deutlich an den Ecken der Traufsteine neben den
Dachrinnen zu sehen (vgl. Herrfurth, K., Die
Wrangelkapelle... [2])(Abb. links). Im 18. Jahrhundert waren einzelne
Vertreter dieses Geschlechtes schon in den Grafenstand erhoben worden.
Einige waren enge Vertraute der preußischen Könige geworden, oder sie hatten
den Posten des Salzgrafen in Staßfurt inne. Die "Hackeschen Höfe" in
Berlin-Mitte gehen auf den aus Staßfurt stammenden Grafen von Hacke zurück,
der Stadtkommandant von Berlin und ein Freund Friedrichs II. war.
Balthasar Joachim
von Haugwitz aus einem alten Geschlecht hatte 1604 die verwitwete
Erbin des Rittergutes Calbe Magdalena von Ingersleben, geheiratet. Als sie
1611 starb, ehelichte er 1618 Sophie von Veltheim, die Tochter des
Schlossvogts Günzel von Veltheim in Calbe, dessen Ritterfamilie in Harbke
ihren Sitz hatte.
Balthasar Joachim von Haugwitz stammte aus einer ursprünglich in Sachsen,
vorwiegend im Gebiet von Meißen und Bautzen, ansässigen Familie. Schon im
12. Jahrhundert tauchten diese umtriebigen Adligen als von Hugwitz, Haubitz
oder Haugwitz auf. (Laut Hävecker [vgl. Hävecker,
a. a. O., S.
80] war dieses Geschlecht vor dem Dreißigjährigen Krieg im Magdeburger
Gebiet zahlreich vertreten, nach dem Kriege dort jedoch "gantz
ausgestorben".)
Schnell breitete
sich die Ritterfamilie in Schlesien, Böhmen, Mähren, Österreich und
teilweise auch in Polen aus. In der polnischen Szlachta nahmen die von
Haugwitz den slawischen Namen Pawlowski an.
Im 15. Jahrhundert hatte die Haugwitzfamilie gute und enge Beziehungen zu
den sächsischen Kurfürsten. Einige von Haugwitz´ waren sogar Kanzler unter
Kurfürst Friedrich II. Hans von Haugwitz stiftete die berühmte
Haugwitz-Kapelle an der Nordseite der Paulinerkirche in Leipzig, die 1944
zerbombt und deren Ruine auf Befehl Ulbrichts 1968 völlig beseitigt wurde.
Georg von Haugwitz brachte es außer zur Kanzlerschaft sogar bis zum Bischof
von Naumburg.
(siehe
unten).
Ein von Haugwitz war kurfürstlicher Richter in Freiberg und in dieser
Funktion mit dem spektakulären Fall von spätmittelalterlichem Kidnapping,
dem so genannten Altenburger Prinzenraub, beschäftigt (vgl.
http://de.geocities.com/steinmetz41/eltern.htm). Mit Johann von Haugwitz
wurde ein bedeutender Protestant Bischof in Meißen. Ein anderer von
Haugwitz, Friedrich Adolf (1637 – 1705), war sächsischer Geheimer Kriegsrat,
Oberhofmarschall und Obersteuerdirektor geworden. Seiner Schwester Ursula
Margarethe und deren Tochter Sibylla gebührt der pikante Ruhm, die ersten
kurfürstlich-sächsischen Mätressen gewesen zu sein, bis sie in Ungnade
fielen und August der Starke gegen sie, auch gegen die 19jährig an den
Pocken verstorbene Sibylla, einen damals viel beachteten Hexenprozess führte
(zum Hexenwahn im 16./17. Jahrhundert vgl. Station 1).
Näheres zu dieser bizarren Geschichte unter
http://de.geocities.com/steinmetz41/eltern.htm.
Zwei der bedeutendsten Mitglieder der Familie waren absolutistische
Staatsmänner in habsburgischen und in preußischen Diensten, der
österreichische Staatskanzler (unter Maria Theresia) Friedrich Wilhelm, seit
1733 Graf, von Haugwitz und der 50 Jahre später lebende preußische
Kabinettsminister (unter Friedrich Wilhelm II.) Christian Heinrich Curt Graf
von Haugwitz.
|
 |
|
Friedrich
Wilhelm Graf von Haugwitz (1702-1765) |
|
 |
|
Christian
Heinrich Curt Graf von Haugwitz (1752-1832) |
Beide waren
bedeutende Reformer innerhalb des „aufgeklärten“ Absolutismus.
Heinrich
Christian Kurt war auch an den späteren Hardenberg-Reformen in Preußen
beteiligt, ein Reisefreund Goethes und mit dem „dicken Lüderjan“ Friedrich
Wilhelm II. in der gemeinsamen Vorliebe für Okkultismus und Mystik
freundschaftlich verbunden.
Der
„Österreicher“ Friedrich Wilhelm Graf von Haugwitz war unter Maria Theresia
schlesischer Landespräsident und führte als österreichischer Kanzler
bedeutende Justizreformen durch. Er war ein Förderer und Gönner Joseph
Haydns.
Ein anderer Freund der Musik war Paul Graf von Haugwitz (1791 – 1856), einer
der Textdichter Ludwig van Beethovens.
Wie Balthasar Joachim als Angehöriger dieser Ritterfamilie, die vorwiegend
im östlichen Teil des Reiches ansässig war, ausgerechnet in die Magdeburger
Gegend kam, bleibt ein Geheimnis. Während des Dreißigjährigen Krieges
starb er "frühzeitig" [1626], wie es in einer gedruckten Leichenpredigt auf seinen
1656 verstorbenen Sohn hieß, in Brandenburg.
Die von Haugwitz und von Schlegel schrieben
auch durch die weiblichen Mitglieder ihrer Familien Geschichte. So war, wie
oben schon hervorgehoben, die Schwiegermutter von Martin Luther eine
geborene von Haugwitz (vgl.
Oliver Dix, Präsident der Akademie für Genealogie, Heraldik und verwandte
Wissenschaften e.V. :Beschreibungen;
http://www.lutheriden.de/main_bes.htm),
und der 27jährige schwedische Generalmajor Carl Gustav Wrangel
heiratete 1640 die 18jährige schöne, aber verarmte Waise
Anna
Margareta von Haugwitz aus Calbe an der Saale.
Die
"Wrangelkapelle" an der St.-Stephani-Kirche kann als durchaus mit ihm und mit seiner Frau in Verbindung
gebracht werden
(vgl. Station 5).
Auch zu den Anhaltinern
pflegten die Rittergutsbesitzer verwandtschaftliche Beziehungen. Fürsten von
Anhalt-Köthen und von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym heirateten
von-Ingersleben- und von-Schlegel-Töchter (vgl. Descendants of Georg I,
Fuerst von Anhalt-Zerbst [gen 6+7 of 16 generations]
http://www.worldroots.com/foundation/royal/georg1anhaltdesc1390-2.htm).